ROLLING STONE hat gewählt: Die Alben des Jahres 2025
ROLLING STONE kürt die besten Alben des Jahres 2025.


Baxter Dury, „Allbarone“
Es war nicht unbedingt damit zu rechnen, dass Baxter Dury mit seinem besten Album abliefern würde. „Allbarone“ macht mit jedem Hören mehr Spaß. Um den Charakter der Platte zu verstehen, reicht es, wenn man sich vorstellt, wie der Mann in einer Filiale der Nobelkette All Bar One sitzt, einen Cocktail schlürft, amüsiert das Treiben beobachtet, auf eine Serviette den Titel „Allbarone“ kritzelt und ihn im Geiste zu einem hedonistischen Fantasieort umphrasiert. Aber Dury hat noch andere geniale Späße auf Lager. Es gibt den maliziösen Techno von „Schadenfreude“, den sardonischen Electro-Punk von „Kubla Khan“, den omnipotent pumpenden Disco von „Alpha Dog“ und den höhnischen Celebrity-Pop von „Hapsburg“. Produzent Paul Epworth hat Dury ein paar Beats und Synthesizer-Effekte maßgeschneidert, die so klingen, als würden die Pet Shop Boys auf schlechtem Kokain einen Exorzismus praktizieren. Wir wissen nicht, wie er es anstellt, doch irgendwie schafft es Dury, dass sein Humor nie zur billigen Nummernrevue verläppert. Und das Schönste: Zu diesen Spotthymnen des 21. Jahrhunderts lässt es sich prächtig tanzen – auch wenn dabei niemand so elegant aussieht wie dieser britische Dandy im Schafspelz. MG

Little Simz, „Lotus“
Gemeinsam mit dem Produzenten und Kindheitsfreund Inflo hat Little Simz zu sich gefunden („Grey Area“, 2019), ein epochales Album aufgenommen („Sometimes I Might Be Introvert“, 2021), eine überzeugende Antwort auf den folgenden Ruhm abgegeben („No Thank You“, 2022) und sich zur aufregendsten HipHop-Künstlerin des Planeten entwickelt. Doch dann kam es zum Bruch. Es ging ums Geld. „Thief/ And you know what it means/ La-la-la, la-la, la/ Selling lies, selling dreams“, rappt Little Simz spöttisch zu elegantem Backing in ihrem unvergleichlichen Flow zu Beginn von „Lotus“, der selbstbewussten Unabhängigkeitserklärung einer Künstlerin, die trotz zahlreicher hochkarätiger Gäste wie Sampha, Michael Kiwanuka, Moses Sumney und Obongjayar sehr bei sich ist, über der erdigen Groove ihrer Band stellenweise tagebuchartig aus dem eigenen Innenleben berichtet, sich verletzlich gibt und kämpferisch und im Titelsong zeigt, dass auch aus dem Schlamm die prächtigste Blüte wachsen kann. „If self-love means putting me first/ It’s the greatest love story on earth“, stellt Little Simz fest, bevor Kiwanuka uns mit Engelszunge in den geigenverhangenen Neo-Soul-Himmel führt. MB

Rosalía, „Lux“
Hier geht es um alles, um Liebe und Schmerz, um die Freuden des Fleisches und die Sehnsucht nach Erlösung und Spiritualität. Rosalía begann als Flamencosängerin, flirtete mit der elektronischen Avantgarde und Reggaeton. Auf ihrem vierten Album hat sie eine ganz eigene Ästhetik entwickelt: verschwenderisch reiche, tief berührende Musik von der größten Pop-Künstlerin der Gegenwart. JB

Cameron Winter, „Heavy Metal“
Waren die Beat Poets einst die expressive Reaktion auf das repressive Amerika der Fifties, sind die surrealen Halluzinationen des 23-jährigen sonstigen Geese-Frontmanns eine logische Antithese zum Trump’schen Wahnwitz. „All these songs are a hundred ugly babies“, singt Winter in „Cancer Of The Skull“. Ein Meisterwerk, eigentlich erschienen Ende 2024, zu spät für die Charts des Vorjahrs. RR

Cate Le Bon, „Michelangelo Dying“
Lebenskategorie, als Michelangelo Buonarroti 1564 starb. Sein Credo: „In meinen Werken scheiße ich Blut.“ Doch darf man sich den Großmeister in allen Klassen schon als erfüllten Menschen vorstellen, als den fast 89-Jährigen mitten in den Arbeiten am Petersdom die Lebenskräfte verließen. Wenn Cate Le Bon den sterbenden Michelangelo nun als Albumtitel bemüht, mag das zunächst auch anmaßend anmuten, es ergibt dann aber eine schlüssige Metapher für das, was in diesen zehn Songs passiert. „On the wrong side of paradise“, wie sie in „I Know What’s Nice“ resümiert, vertraute sich auch Le Bon nach einer Verlusterfahrung ganz ihrer Kunst an, um Schmerz in Schönheit zu verwandeln. „It’s alright, it’s alright, it’s just feelings going away“, beschwört sie in „Ride“, assistiert von Fellow-Waliser John Cale. Dass sie dabei als Ideal für den Sound von „Michelangelo Dying“ eine Installation von Colette Lumiere vor Augen und Ohren hatte, zieht den Kunstbezug ins Zeitgenössische. Gegen Bekenntniskitsch ist Le Bon eh durch ihren ausgeprägten Form- und Stilwillen immunisiert, bezeugt auch durch ihr Begleitensemble. Saxofonist Euan Hinshelwood, Pianist Paul Jones, Drummer Dylan Hadley und Perkussionistin Valentina Magaletti helfen, die Musik in ein flächiges Schweben zu bringen, fast wie gemalt für diese sich nach Ruhe sehnende Frau, die Le Bon bei Lumiere sah. Die Ästhetisierung des Schmerzes, mit leichtem Zug auch ins Absurde, verhüllt diesen jedoch nicht, sondern macht ihn gerade sichtbar in Songs wie „Love Unrehearsed“ oder „Is It Worth It (Happy Birthday)?“. Vom Pop-Appeal eines „About Time“ oder „Heaven Is No Feeling“ zu schweigen. Was für ein Glück. JF

Tristan Brusch, „Am Anfang“
Eins der wenigen deutschen Alben, auf die sich mal wieder alle einigen können: Der Abschluss von Tristan Bruschs Trilogie ist ein Meisterwerk für Romantiker. „Am Anfang“ handelt von leidenschaftlichen Beziehungen, die selten gut ausgehen – und lässt keinen Zweifel daran, dass „Die Liebe in Maßen“ Quatsch ist. Opulenter, nie aufdringlicher Chanson-Pop, im besten Sinne zeit- und kompromisslos. BF
Die Alben des Jahres 2025: Van Morrison, DJ Koze und andere

Sophia Kennedy, „Squeeze Me“
Die US-Hamburgerin mit Drähten nach Berlin bleibt unberechenbar: Auf ihrem dritten Album, erneut mit Mense Reents entstanden, spannt sie einen weiten Bogen von Avant-Pop bis Melody-Punk. Sie fährt Lkw, beobachtet dabei die schlafende Mutter und steigert sich ins flammende Finale „Hot Match“ hinein. Dabei begegnen uns seltsam eigenwillige Figuren („Imaginary Friend“). RN
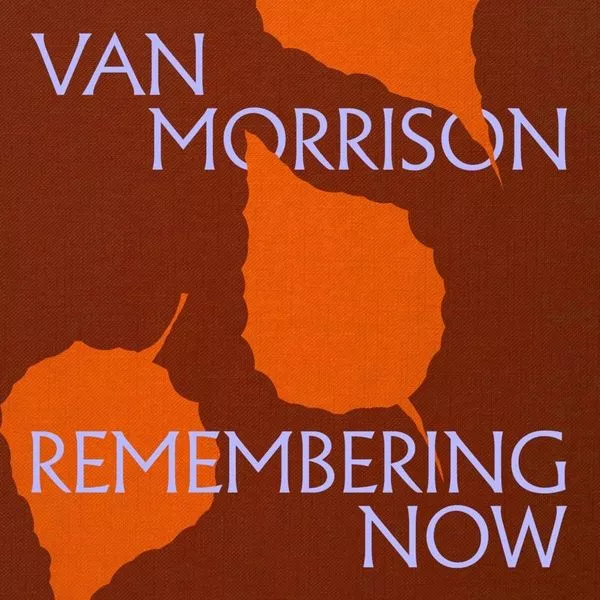
Van Morrison, „Remembering Now“
Man erwartete nicht viel von einer neuen Platte des Meisters. Aber er selbst erwartete viel von sich. „Remembering Now“ ist eine nostalgische, aber nicht nostalgieselige Rückschau und Bestandsaufnahme. „Haven’t lost my sense of wonder“, singt Morrison zu dem wohlbekannten Background aus Piano, Orgel und Bläsern. In „Back To Writing Love Songs“ erinnert er sich selbst daran, was er so gut kann. AW

DJ Koze, „Music Can Hear Us“
Das hat nur noch am Rande mit Clubmusik zu tun. Es ist Sehnsuchtsmusik und Stefan Kozalla einer der großen Produzenten und Soundkünstler unserer Zeit. Seine beglückenden Songs und Skizzen mit ihren Klavierpirouetten und Orgel-Arpeggios, schlurfigen Beats und verhallten Saxofonen sind das Beste, was Koze je gemacht hat. Unsere Herzen pochen, die Musik hört uns zu. SZ

Big Thief, „Double Infinity“
Big Thief mögen mit Bassist Max Oleartchik eine Stütze verloren haben, aber ein Hund läuft auch mit drei Beinen. Die Musik der New Yorker bleibt weiter vielgesichtig. Adrianne Lenker singt von Anfängen und Abschieden und von all den Dingen, die mehr als eine Perspektive haben. Wir lernen: Das Leben mag „Incomprehensible“ sein, aber wer neugierig bleibt, erträgt es mit Zuversicht. MV

Wet Leg, „Moisturizer“
Rhian Teasdale und Hester Chambers tun so, als ob nichts gewesen wäre. Genauso cool, catchy, noisy, trotzig und wild wie auf ihrem Debüt verjagen sie in Songs wie „Catch These Fists“ oder „Mangetout“ aufdringliche Typen, träumen in „Pillow Talk“ von einer Nacht mit Calamity Jane, in „Liquidize“ von Marshmallow-Würmern – und machen den besten, lustigsten Indie-Rock, den es derzeit gibt. GR
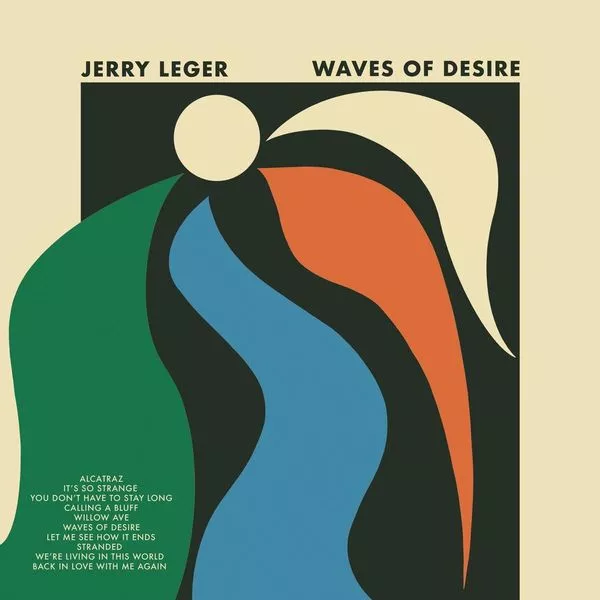
Jerry Leger, „Waves Of Desire“
Immer wenn Jerry Leger „Yes It Is“ von den Beatles hört, fühlt er sich in die Zeit zurückversetzt, da er es als Kind bei Autofahrten hörte. Andere wollten Astronaut oder Feuerwehrmann werden – Leger Musiker. Er liebte Roy Orbison, die Everly Brothers, die Zombies. Und er träumt weiter. Bei „Waves Of Desire“ gelang ihm ein warmer, organischer, orgeliger Klang. „Pure Pop For Jerry People“. AW
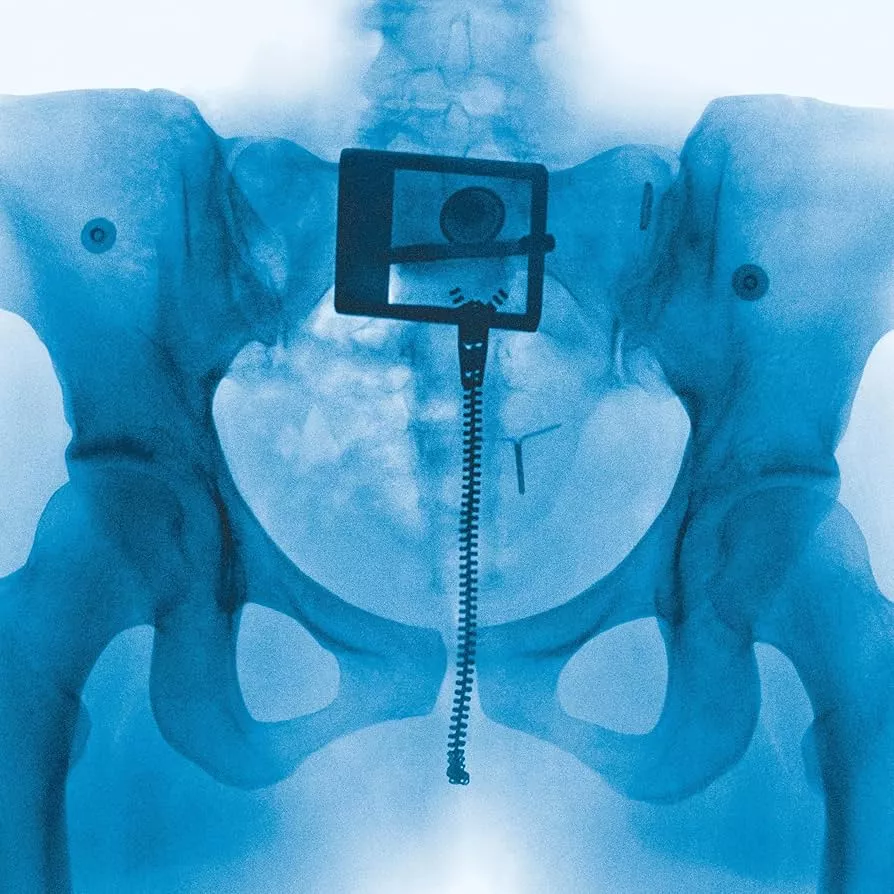
Lorde, „Virgin“
Lorde ist 29 und veröffentlichte ihr Debüt mit 17. Lange genug her, um sich auf dem vierten Album von Pop-Hymnen loszusagen und mit mehr Wucht denn je emanzipatorische Themen in den Mittelpunkt zu stellen: Körperwahrnehmung und Geschlechterrollen. Verzerrte Synthesizer erzählen von der Zukunft; viele Pausen – nicht zu verwechseln mit Leerstellen – verleihen ihren wenigen Worten Gewicht. SN

Midlake, „A Bridge To Far“
Mit ihrem dritten Album nach dem Ausstieg von Tim Smith kehren die Texaner zu ihren Ursprüngen zurück. Aus fein-melodischem Psych-Folk und musikverliebtem Jazzrock entsteht jene Alchemie, die Midlake einst zu einer Sensation machte. Nun ist die Inspiration vollständig zurückgekehrt – in einem vielseitigen Repertoire, das Produzent Sam Evian auf hervorragende Weise zum Klingen bringt. JS

The Weather Station, „Humanhood“
Tamara Lindeman hat die anmutigste Trilogie der jüngeren Popgeschichte vollendet. Wie auf „Ignorance“ (2021) und „How Is It That I Should Look At The Stars“ (2022) verweben The Weather Station Folk, Jazz, Pop und Ambient zu einer fluiden Kunstmusik, die ein natürliches Gleichgewicht zwischen Psychologie, Spiritualität und Ökologie findet. MG

Blood Orange, „Essex Honey“
Eine Rückkehr in die Kindheit, nach Hause, wo Devonté Hynes seine todkranke Mutter pflegte. Die inhaltliche Schwere des fünften Blood-Orange-Albums spiegelt sich kaum in seiner leichtfüßigen, flirrenden, in Soul, R&B und Pop grundierten Musik, in der ein gestrichenes Cello einen lässigen Beat stoppt oder umgekehrt ein Stakkato-Beat den Soundnebel vertreibt. Und einen Satz singt er auf Deutsch. SZ

The New Eves, „The New Eve Is Rising“
Nichts klang in diesem Jahr explosiver als diese vier in weiße Gewänder gekleideten Prophetinnen aus dem englischen Brighton, die sich nach Angela Carters feministisch-surrealistischem Roman „The Passion Of New Eve“ benannten. Auf ihrem Debüt verbinden sie die Melancholie des britischen Folk mit der Energie des Punk, der Avantgarde von The Velvet Underground und der Poesie von Patti Smith. MB

Cass McCombs, „Interior Live Oak“
Kolossal: Dem Bay-Area-Songwriter gelingt ein fast 75-minütiges Werk, auf dem keiner der 16 Songs fehlen darf. Ob Californication („Peace“), Folk-Introspektion („Missionary Bell“), Cowboy-Fantasie („I Never Dream About Trains“), Farfisa-Jangle („Juvenile“) oder das Fuzz-Finalstück: McCombs zieht alle Register, ohne sich zu verzetteln. „I’m Not Ashamed“ ist sein „Je ne regrette rien“, ganz ohne Piaf-Pose. JF

Ezra Furman, „Goodbye Small Head“
„Springsteen hat anscheinend das Gebäude verlassen“, sagt Ezra Furman selbst über ihr siebtes Soloalbum. War sie vor einigen Jahren noch eine Art weibliche Indie-Rock-Version des großen Bruce, sprengt „Goodbye Small Head“ jegliche Erwartungen und Formate. Furman braucht keine Refrains oder klassische Songstrukturen, ihre Ideen explodieren in alle Richtungen. Dringlich, dramatisch. BF
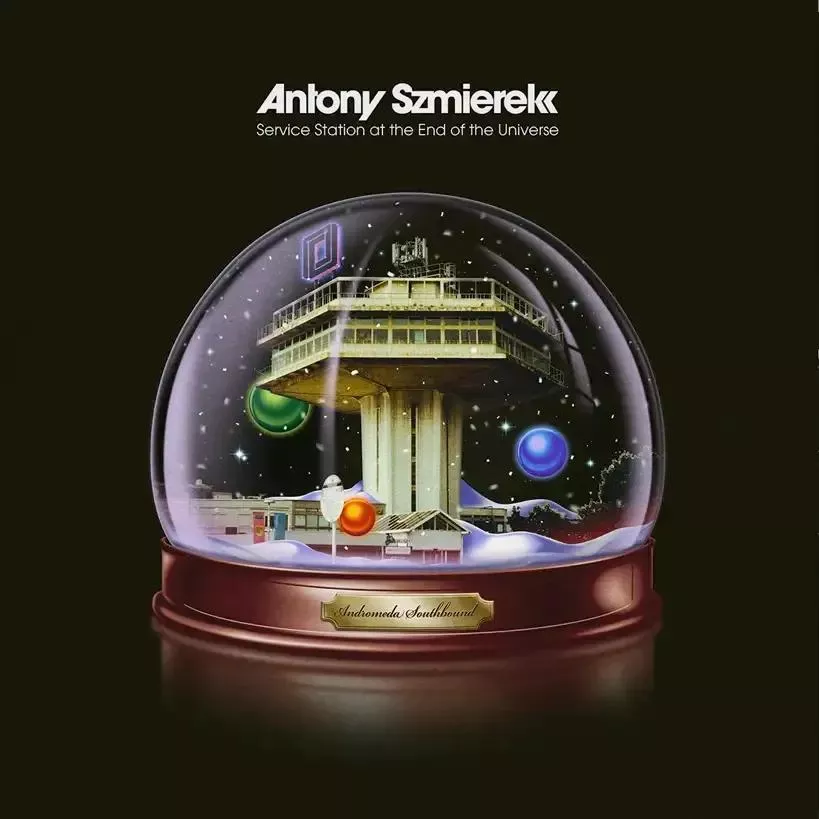
Antony Szmierek, „Service Station At The End Of The Universe“
Ja, es gibt sie tatsächlich – die gesungene Pyramide von Stockport. Gerade ist sie in aller Munde, da in dem ehemaligen Bürogebäude nun ein indisches Restaurant eingezogen ist. Eine Kuriosität, die den Weg zu einem der besten, wenn nicht dem besten Debüt des Jahres 2025 weist. „Service Station At The End Of The Universe“ ist nämlich alles. Kosmopolitisch und typisch englisch. Surreal und wirklichkeitsnah. Schlau und simpel. Saulustig und bierernst. Warmherzig und pragmatisch. Weltumarmend und eigenbrötlerisch. Authentisch und träumerisch. Emotional und abgeklärt. Euphorisch und düster. Arrogant und sexy. Weltmännisch, aber mit Manchester-Akzent. Ein 36 Minuten und 37 Sekunden langes Augenzwinkern! Mit der Street(s) Credibility eines Mike Skinner und beiden Beinen in der neuen Rave-Kultur kombiniert der Mann mit dem Pornobalken Hip-Hop mit Post-Punk und Spoken Word à la Kae Tempest. House-Pianos treffen auf Chic-Basslines, Garage-Sounds und Breakbeats, warme Synthie-Passagen liefern sich ein Tackling mit Underworld-Gepolter. Wenn’s um Liebe geht, darf natürlich ein Gospelchor nicht fehlen. Als wäre John Cooper Clarke in der Hacienda groß geworden! Jeder Songtitel hat sowieso einen Sonderpreis verdient. Ganz vorne: „The Hitchhiker’s Guide To The Fallacy“. Das „Restless Leg Syndrome“ und der „Yoga Teacher“ werden genauso thematisiert wie der in englischen Supermärkten angepriesene Meal Deal, bei dem die guten Sachen nie inbegriffen sind. „Poems To Dance To“, so hieß mal eine EP des ehemaligen Lehrers. Jetzt liefert er die Party des Jahres 2025 und eine Platte mit einem ganz großen Herzen. FL

Ryan Davis & The Roadhouse Band, „New Threats From The Soul“
Der amerikanische Songwriter Ryan Davis ist ein neugieriger Beobachter der Innen- und Außenwelt und kann seine Beobachtungen sehr originell und pointiert in Worte fassen. Auf dem zweiten Album mit seiner Roadhouse Band geht es um die Suche nach Liebe, nach Erfüllung und Erlösung – und um die Fallen, die wir uns selbst dabei stellen. Vor allem aber um das, was wir tun, um uns von der Unmöglichkeit des Findens abzulenken: Bier trinken, Witze reißen, Glühwürmchen aufladen, uns in Beziehungen begeben, die zum Scheitern verurteilt sind. Um das Alltägliche und das Tiefgründige also, das Heilige und das Profane. Und alles endet an dem Ort, an dem einst der amerikanische Idealismus seinen Anfang nahm: Am Walden Pond nahe Concord/Massachusetts, wo Henry David Thoreau zwei Jahre lang abgeschnitten von der Zivilisation ein bewusstes und einfaches Leben führte, um später in „Walden; Or, Life In The Woods“ davon zu berichten, den Materialismus und Konformismus der Gesellschaft zu kritisieren und ein spirituelles Leben in innerer Freiheit zu propagieren. Nur ist der Walden Pond bei Davis zum „Walden Pawn“ geworden, also zum Pfandhaus, in dem man das, was übrig ist von den alten Idealen, gegen Geld eintauschen kann. Die Roadhouse Band klingt wie eine alte, mit den traurigsten Country-Songs bestückte Jukebox in der verstaubten Ecke eines lange verwaisten Honkytonks, die einem allerdings ab und zu ein bisschen unheimlich wird, wenn sie etwa plötzlich synkopierte Breakbeats ausspuckt. Und Davis diktiert Zeilen wie „I learned that time is not my friend or my foe, more like one of the guys from work“ in die geschundene Seele. MB

Alabaster DePlume, „A Blade Because A Blade …“
Ein Trauermarsch, der sich in einer himmelwärts trabenden Improvisation auflöst, so beginnt das siebte Album des Briten, und er nimmt diese gemütvolle Melodie an drei Stellen noch einmal auf. De Plumes wimmerndes Saxofon und sein Sprechgesang treffen auf Chöre, Streicher, Percussion. Ist das Jazz? Es ist transzendierende Musik. Wie Moondog. Göttlich. SZ

Steve Gunn, „Daylight Daylight“
Alle paar Jahre lässt der New Yorker Abstraktionist der Gitarrenkunst sich zu Exkursen ins figurative Songwriting hinreißen. Unter Aufsicht von Produzent James Elkington zart orchestrierte Stücke verarbeiten in kodierter Poesie schwere Themen wie den Verlust seines Fingerpicking-Mentors Michael Chapman („Hadrian’s Wall“) oder den Suizid eines alten Freunds („Morning On K Road“). RR

Annahstasia, „Tether“
Beim ersten Hören fällt es schwer, dieses Album einzuordnen, weil es so herrlich aus der Zeit gefallen klingt: Irgendwie nach Neunzigern, nach Soul, Jazz und Folk, nach Tracy Chapman und nach Anohni zugleich. Annahstasias Debüt ignoriert Trends und Konventionen. Es sind nicht elf Songs, sondern Hymnen – und eine jede ist ein emotionales Feuerwerk. Zerbrechlich und unfassbar stark. NVM

Haim, „I Quit“
Das „loud quitting“ des Schwester-Trios macht nur Halt vor Co-Autor/Produzent Rostam Batmanglij, der Classic-Rock-Referenzen („Gone“) mit nervösen Drum-Sounds bricht, in „Relationships“ lässig moderne R&B-Codes variiert oder „The Farm“ hinterm Mellotron-Schleier versinken lässt. „Everybody’s Trying To Figure Me Out“ kontert alle Zuschreibungen ihrer Emotionsdialektik souverän. JF

The Divine Comedy, „Rainy Sunday Afternoon“
Auch auf seinem 13. Album zelebriert Neil Hannon verlässlich exquisiten Kammerpop, der sich von düsteren Themen (Verfall, Vergänglichkeit, Weltgeschehen!) nicht die Freude an hinreißenden Melodien und so gewitzten wie elegant-nostalgischen Arrangements nehmen lässt. Dass die Platte mit einem großen Orchester in den Abbey Road Studios eingespielt wurde, erscheint standesgemäß. ISM

.jpeg)

