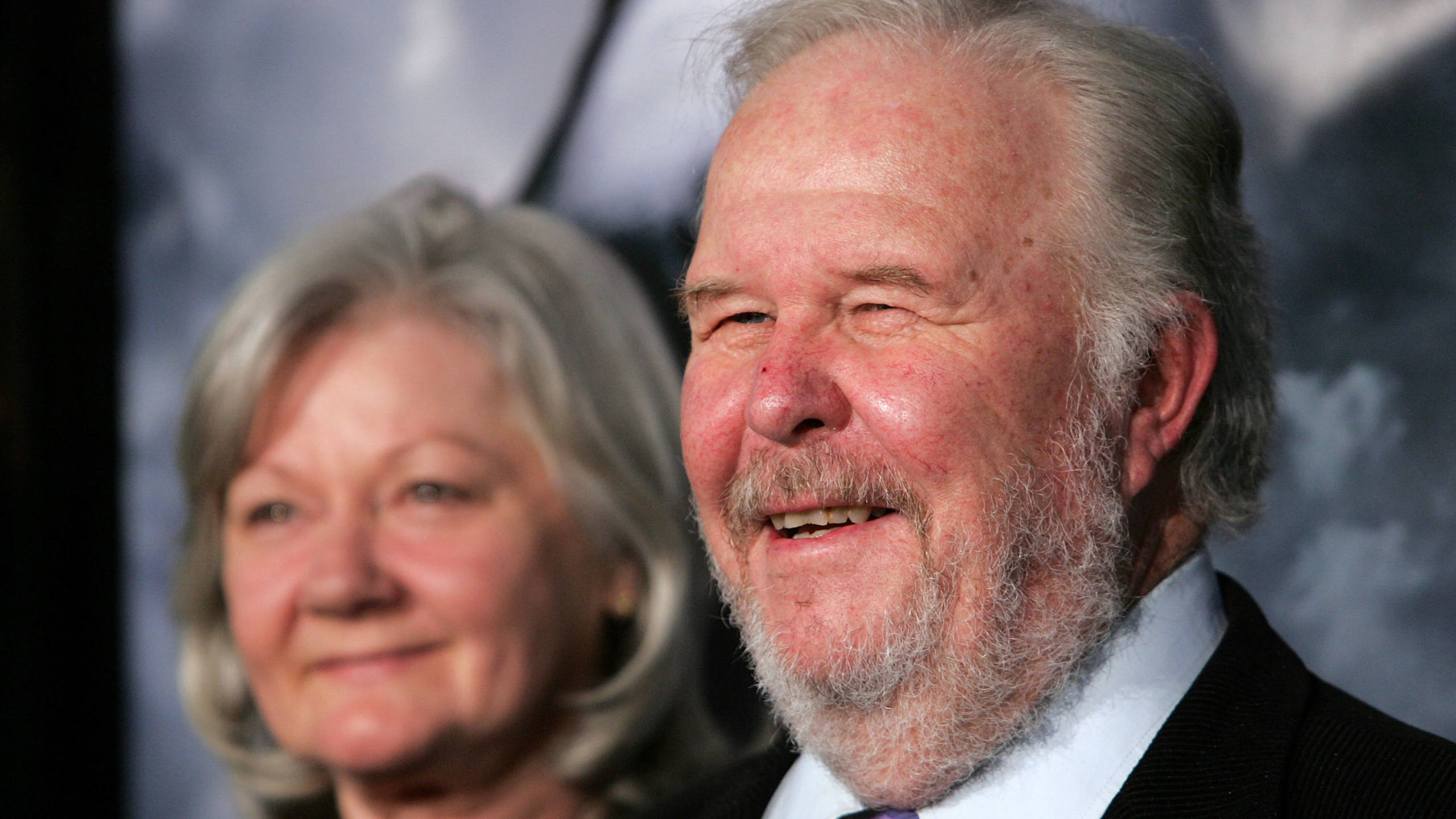Hat einer der größten Filme von 1976 unsere kaputte Gegenwart vorhergesagt?
Zum 50. Jubiläum wirkt „Network“ aktueller denn je – eine bittere Medien-Satire, die unsere Gegenwart erschreckend genau traf.

Es passiert erst zur Hälfte des Films. Vielleicht erinnern Sie sich daran, dass die berühmteste Szene in „Network“, Paddy Chayefskys und Sidney Lumets Blick auf Fernsehnachrichten, Boulevardkultur, Konzernübernahmen und die Form der kommenden Dinge, näher am Anfang des Films stattfindet. Wir müssen Ihnen nicht sagen, welche wir meinen: Ein Nachrichtensprecher namens Howard Beale, berauscht von Prophezeiung und Klarheit, erhebt sich von seinem Ankertisch.
Nachdem er alles heruntergerattert hat, was in der Welt vor Ihrem Fenster schiefläuft – Arbeitslosigkeit, Kriminalität, Umweltverschmutzung, eine schwächelnde Wirtschaft –, hat der Herr nun eine Bitte an seine Zuschauer. Er fordert sie auf, sich vorübergehend aus ihrem Zustand permanenter Isolation zu lösen und Teil eines kollektiven Chors zu werden, ihre Fenster zu öffnen und in die Leere zu schreien. Sagen Sie es mit uns: „Ich bin so wütend, ich halte das alles nicht mehr aus!“
Sehen Sie es sich noch einmal an, falls Sie es länger nicht getan haben. Sie werden überrascht sein, wie wirkungsvoll, wie geradezu elektrisierend und erschütternd das alles immer noch ist.
Ein Film wie frisch erschienen
Veröffentlicht im Jahr des zweihundertjährigen Bestehens Amerikas, wird „Network“ in diesem Jahr 50 Jahre alt. Sehen Sie sich den kompletten Film jetzt noch einmal an – zumal die „Criterion Collection“ gerade eine schöne Blu-ray-Edition veröffentlicht hat, was ganz oben auf Ihrer To-do-Liste stehen sollte; unterstützen Sie physische Medien! – und es fühlt sich an, als sei er 50 Minuten alt. Nur die verdorbenen Medien der Massenkommunikation haben sich verändert. Jahrzehntelang galt er als schonungsloser, düster-komischer Blick darauf, wie die Rundfunknachrichtenbranche mit dem Unterhaltungsindustriekomplex verschmolzen und schließlich von den Mächtigen ausgebeutet werden könnte.
„Könnte“ ist hier längst nicht mehr das richtige Wort. Etwa zehn Jahre nachdem der Film vier Oscars gewann, wurde die Fairness-Doktrin abgeschafft, und wir hatten einen ehemaligen Filmstar im Weißen Haus, der dafür bekannt war, in politischen Sitzungen Popkultur-Zitate zu verwenden. Zwanzig Jahre nach seiner Veröffentlichung begann Fox News seinen Marsch Richtung Bethlehem. Dreißig Jahre nach dem Kinostart von „Network“ begegnete man einer unterhaltsamen neuen App namens Twitter. Vierzig Jahre später ist es 2016, und … ja. Genau. Sehen Sie den Film heute, und es ist, als würde eine Nation von Bürgern mit einer Feinschmecker-Leidenschaft für Menschenfleisch Jonathan Swifts „A Modest Proposal“ lesen und denken: Moment, das sollte satirisch sein?!
Weder Satire noch Fiktion
Lumet und Chayefsky betrachteten „Network“ nie als Satire; sie bezeichneten ihn stets als „Reportage“. („Die Branche satirisiert sich selbst“, wurde Letzterer zitiert.) Sowohl der Regisseur als auch der Drehbuchautor, der „Ich bin so wütend“ in ein allgemeines Mantra gegen das System verwandelte, kamen aus dem Fernsehen, wenn auch nicht aus den Nachrichtenredaktionen. Beide begannen in den frühen Tagen des Live-TV-Dramas und fanden schließlich ihren Weg ins Kino.
Lumet wurde zu einem vielseitigen Filmemacher mit besonderem Gespür für Schauspieler und wechselte von gesellschaftskritischen Parabeln wie „The Pawnbroker“ und „Fail Safe“ sowie Theateradaptionen wie „Long Days Journey Into Night“ und „The Seagull“ zu den New-Hollywood-Großstadtgeschichten New Yorks wie „Serpico“ und „Dog Day Afternoon“. Chayefsky galt ursprünglich als Chronist des kleinen Mannes mit starkem Kontrollbedürfnis und erlangte nach dem Erfolg seiner 1950er-Charakterstudie „Marty“ genug Einfluss, um diesen durchzusetzen. Doch sein Drehbuch für den Film „The Hospital“ von 1971 zeigte eine gerechte Empörung darüber, wie das amerikanische Gesundheitssystem seine Ärzte und Patienten im Stich ließ. Es dauerte nicht lange, bis er seinen Blick, seinen Stift und seinen Zorn auf eine andere Institution richtete.
Beide hatten aus erster Hand Erfahrung mit den Machern des Fernsehgeschäfts, die ihre Gehälter nicht mehr zahlten, aber weiterhin bestimmten, wie sie – und alle anderen Mitte der Siebziger – die Ereignisse des Tages verarbeiteten. Als wir Howard Beale (gespielt von Peter Finch) kennenlernen, ist er das fiktive Pendant zu Walter Cronkite.
Die Geburt eines Medien-Messias
Sein Privatleben hat ihn jedoch aus der Bahn geworfen, und er steht kurz vor der Entlassung. Der Präsident der Nachrichtenabteilung und Beales alter Weggefährte Max Schumacher (William Holden) nimmt seinen Freund auf einen Drink mit. Howard sagt, er werde den Leuten geben, was sie wollen, also Sensationalismus, und sich live im Fernsehen umbringen. Max schlägt vor, seinen Tod zu einer wöchentlichen Reihe zu machen: „Selbstmord der Woche“. In seiner Abschiedsrede am nächsten Abend wiederholt Howard seinen „Scherz“. Niemand weiß, ob es sich nur um Galgenhumor eines depressiven Mannes handelt oder um etwas Ernsteres. (Tatsächlich gab es ein reales Vorbild.)
Messias der Massenmedien
Dann tritt Diane Christensen (Faye Dunaway) auf. Eine Programmdirektorin, teils aufstrebende Machtfigur der nächsten Generation, teils Spitzenprädatorin – sie hätte im Jahr zuvor die Schurkin in „Jaws“ spielen können –, glaubt, im Zusammenbruch des Star-Moderators das Erfolgsrezept des Senders gefunden zu haben. Ihre Idee ist, Beale als „verrückten Propheten der Lüfte“ zu vermarkten, als jemand, der als lautstarke Stimme des Volkes fungieren kann. „Das amerikanische Volk will jemanden, der seine Wut für es artikuliert“, erklärt sie. Außerdem könne sein Aufstieg als Vorlauf für ihr Herzensprojekt dienen: eine Serie über eine militante linke Organisation, komplett mit einer kooptierten Erbin à la Patty Hearst, die körniges, selbstgedrehtes Material von Überfällen zeigt.
1976 war die Vorstellung, einen „offensichtlich unverantwortlichen Mann ins nationale Fernsehen zu setzen“, der eine kompromisslose Botschaft gegen das Establishment predigt und politische Brandstifter zu Quotenstars machen will, ungeheuerlich. 2026 würde beides als harmlos gelten – wobei die Sendungen dennoch reichlich Memes erzeugen und Millionen Follower auf ihren jeweiligen YouTube-Kanälen sammeln würden. Ungeachtet dessen steigen die neuen Unternehmenseigentümer des Senders, verkörpert durch den verstorbenen Robert Duvall als Apparatschik der Führungsetage, ein. Beale wird zum Messias der Massenmedien.
Die Abendnachrichten verwandeln sich in eine Varietéshow mit Wahrsagern und Showansager. Was als spontaner Aufruf begann – „Ihr müsst sagen: ‚Ich bin so wütend, ich halte das alles nicht mehr aus!‘ Ich bin ein Mensch, verdammt! Mein Leben hat Wert!!!“ – endet als nachgeplapperter Sprechchor. Rebellion wird in Pro-Kapitalismus-Slogans umgewandelt. Die Quoten sinken. Die linken Militanten aus Christensens Projekt ermorden Beale während seiner Sendung. Ein bemerkenswertes Crossover.
Vom Kultfilm zur Realität
Die Kritiker waren gespalten, das Publikum unterhalten, Fernsehverantwortliche und reale Pendants zu Beale entsetzt, Oscar-Wähler begeistert. Man erkennt bis heute den Einfluss des Films mit seiner Verachtung für seelenlose Konglomerate, unmoralische Medienakteure und opportunistische Aktivisten. „Network“ war für zehn Oscars nominiert und gewann vier. Peter Finch starb während der Werbekampagne an einem Herzinfarkt und wurde als erster postum mit dem Oscar als Bester Hauptdarsteller ausgezeichnet.
Auch Chayefsky gewann für das Beste Drehbuch. Weniger als fünf Jahre später war auch er tot. Beide hatten glanzvolle Karrieren mit Höhen und Tiefen, doch dieser Film ist der Grundpfeiler ihres Vermächtnisses. „Ich bin so wütend“ mag heute nicht mehr in Leitartikeln stehen oder T-Shirts zieren wie 1976, doch der Satz hat weiterhin Gewicht. Beales Predigt zur besten Sendezeit bleibt einer der berühmtesten Monologe der Filmgeschichte.
Weniger bekannt, aber vielleicht noch treffender in Bezug auf unsere gegenwärtige Lage, ist eine folgende Szene. Beale hat seine Konzernchefs wegen eines Deals mit den Saudis angegriffen. Der Vorstandsvorsitzende bittet ihn zum Gespräch. Auch er hat einiges zu sagen.
Es gibt kein Amerika
Das Fernsehen ist dem Internet gewichen, Nachrichtensprecher Content-Erstellern und Podcast-Meinungsführern, faktenbasierter Journalismus „Ideen-Scoops“. Die Version der „The Mao Tse Tung Hour“ von 2026 würde man nicht im Fernsehen sehen, aber mit Sicherheit im hauseigenen Streamingdienst. In Bezug auf Einflussnahme von Konzernen auf Nachrichten sprechen Sie mit den Redaktionen von „60 Minutes“ oder Stephen Colbert, einem erklärten „Network“-Fan.
Die Amerikaner wollten jemanden, der ihre Wut artikuliert – und sie bekamen ihn. Er erhielt sogar eine zweite Staffel. Es gibt kein Amerika. Und es gibt keine Demokratie. Es gibt nur Meta und OpenAI und Amazon und Skydance und Google.
Die Geschichte unserer Nation ist gezeichnet von Gräueltaten, Unterdrückung, Terror und Gewalt. Geschichte ist nicht schön. Doch das eine, worüber sich ein gespaltenes Land derzeit einig ist: Was in diesem Zeitalter des großen Rückschritts geschieht, ist nicht normal, ungeachtet aller Versuche, es zu normalisieren. Nicht einmal niedrige Einschaltquoten stoppen es.
„Network“ blickte in seine Kristallkugel und sendete eine Tirade des schlimmsten Falls, die bei genauer Betrachtung auch eine Warnung war. Wir leben nicht nur in Howard Beales Welt. Wir stecken in einer Welt fest, die von Millionen Diane Christensens bestimmt wird. Fünfzig Jahre später ist Lumets und Chayefskys brillantes Kunstwerk weder Satire noch Reportage. Es ist ein Horrorfilm. Es ist Realität.
.jpg)