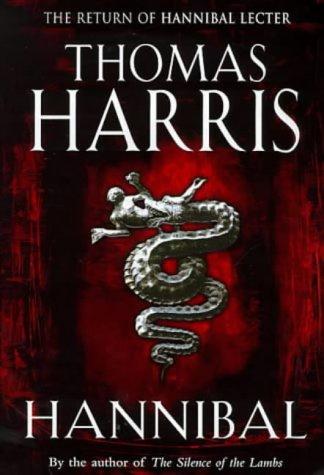Romane: Alle Bücher von Thomas Harris im Ranking
Alle Romane von Thomas Harris im Ranking – von „Black Sunday“ bis „Cari Mora“
Mit „Cari Mora“ veröffentlichte Thomas Harris im Mai 2019 seinen ersten Roman seit 16 Jahren. Wie gut ist das Buch, sein erstes ohne Hannibal Lecter seit seinem Debüt „Black Sunday“ von 1975?
Das Ranking beginnt mit „Black Sunday“. Es ist nicht sein schlechtestes Buch, es ist halt nur sein sechstbestes. Harris hat eine makellose Bibliographie.
06. „Black Sunday“ (1975, deutsch „Schwarzer Sonntag“)
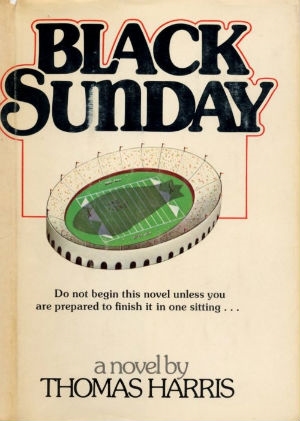
Für jeden Araber, der fortan durch die Hand eines Israeli stirbt, soll ein Amerikaner sein Leben lassen. Der „Schwarze September“, in Europa gefürchtet seit dem Anschlag auf die israelischen Sportler bei den Olympischen Spielen in München 1972, plant einen Terroranschlag auf US-Boden.
Die Attentatswellen der Palästinenser und die Vergeltungsmaßnahmen der Israelis waren, gemeinsam mit den Aktionen von RAF und IRA, der allgegenwärtige Terrorismus der 1970er-Jahre. Thomas Harris schickt seinen –fiktiven – Drahtzieher von München, Muhammad Fasil, gemeinsam mit dem – fiktiven – Koordinator der Angriffe in Frankreich und Italien, Abu Ali, nach Amerika.
Der Feind in den eigenen Reihen
Harris brachte nun eine Idee ins Spiel, die für amerikanische Patrioten für damalige Zeiten unerhört, für jeden anderen Amerikaner furchterregend war: die eines Schläfers aus den eigenen Reihen. Der Pilot Michael Lander ist ein Vietnam-Veteran mit Symptomen, die man heute als Posttraumatische Belastungsstörung bezeichnen würde. Er wurde als Vietcong-Gefangener gefoltert und fühlt sich nun in der Heimat nicht ausreichend versorgt.
AmazonAus Rache an der Regierung, aber auch aus blinder Liebe zur Palästinenserin Dahlia beteiligt er sich am Plan eines Selbstmordattentats. Mit einem Zeppelin will er beim Super-Bowl-Finale über das Tulane-Stadion von New Orleans fliegen und eine Splitterbombe zünden. Damit tangierte Harris 1975 heute noch hochaktuelle Themen: Anschläge bei Massenveranstaltungen, wie eben bei einem American-Football-Spiel, haben hohe Symbolkraft. Dazu die Gehirnwäsche bei einheimischen Kollaborateuren.
Harris ist Autor von Thrillern, nicht politischen Analysen. Analysen schließen eindeutige Ursache-Wirkung-Zusammenhänge meist aus, verhindern also klare Zuschreibungen von Täter- und Opferrollen. Der Literat Harris aber braucht Protagonisten und Antagonisten. In seinem Plot sind die Mossad-Agenten also die Guten, die palästinensischen Terroristen die Bösen. Attentats-Planerin Dahlia bekommt beim Gedanken an zerfetzte Körper buchstäblich erigierte Brustwarzen. In einem späteren Vorwort schrieb Harris, dass er Gefallen an der Figur gefunden hatte, derart, dass er sich inspiriert fühlte, die FBI-Agentin Clarice Starling zu entwerfen.
Die interessanteste Figur bleibt hier jedoch die des Veteranen Lander. Sein Hass auf Amerika ist nicht politisch, ihm liegt eine Kränkung zugrunde. Die Palästinenserin Dahlia ist dagegen konditioniert.
Der Mossad und das israelische Militär, so scheint es hier, sind jedenfalls straffer organisiert als die US-Geheimdienste. „Die Amerikaner nehmen sich ihre Zeit“, urteilt der israelische Agent Kabakov, der den Anschlag verhindern will. Ein US-Ermittler wundert sich derweil über das Attentatsziel: „Beim Super Bowl spielt doch gar kein jüdisches Team.“ Es ging eben um die neuartige Planung von als besonders effektiv betrachteten Anschlägen: Es sollten gerade Unschuldige sein, die in Mitleidenschaft gezogen werden.
Und doch haben die Israelis laut Harris den strategischen Vorteil. US-Veteran Lander streitet sich mit dem Palästinenser Fasil: „Deshalb schlagen euch die Israelis mit solcher Beständigkeit. Ihr denkt ständig nur nach Rache, wegen dem, was euch in der letzten Woche angetan wurde. Und dafür setzt ihr alles andere aufs Spiel, nur für die Rache.“
05. „Cari Mora“ (2019)
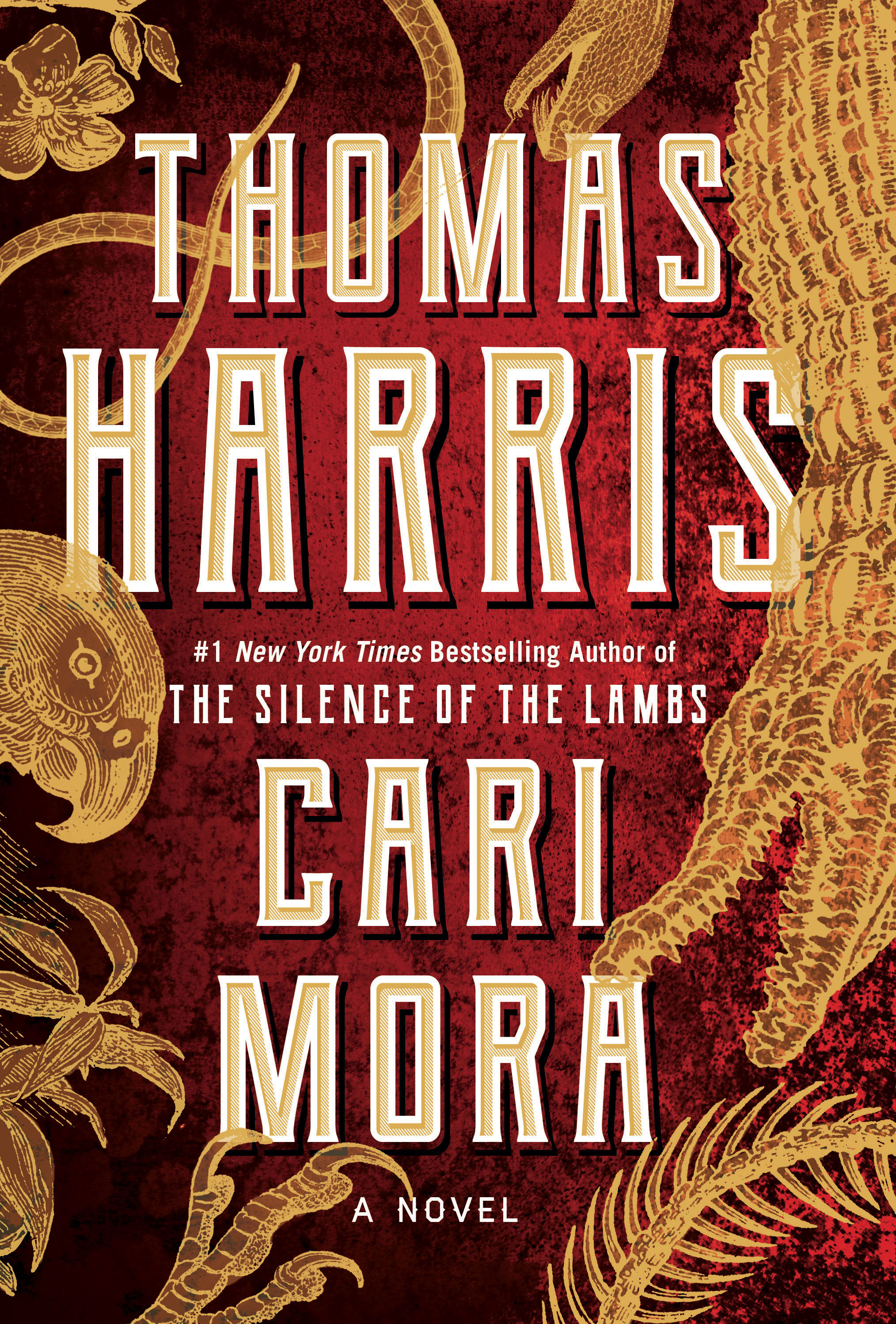
44 Jahre nach seinem Debütroman „Black Sunday“, der vom Terror des „Schwarzen September“ und Vergeltung durch die Israelis erzählte, widmet sich Thomas Harris wieder dem politischen Thriller. Dass er ausgerechnet aus einer nach Amerika emigrierten Ex-Soldatin der FARC, der linken Guerilla-Bewegung Kolumbiens, eine Kämpferin für Umwelt und liberale Einwanderungsgesetze macht, ist sein Seitenhieb auf die US-Regierung.
Caridad „Cari“ Mora arbeitet auf einer Seevogelstation und befreit im Müll gefangene Tiere (der von Menschen verursachte Dreck an den Stränden wird einem ihrer Freunde noch zum Verhängnis werden). Mit den in Miami Beach lebenden Kubanern teilt sie Wissen über die Vielfalt des Fallobsts in den Vorgärten, über Ressourcen also, die die Amerikaner in ihren vier Wänden nicht wertschätzen. Harris geht noch weiter, schreibt: Es ist bereits ein Fehler, Bücher über Natur und Gartenbau für unpolitisch zu halten.
„Miami wurde von Menschen errichtet, die oft zu Fuß aus anderen Ländern eingewandert sind“, schreibt er weiter. Die Ironie ist, dass Caris Schutzstatus als Einwanderin und FARC-Deserteurin durch „begründete Furcht“ belegt werden muss, sie jedoch keine Angst vor dem Bösen verspürt. Als Haushälterin in der ehemaligen Miami-Villa Pablo Escobars begegnet sie Gangstern, die einen Schatz im vom Ozean gefluteten Keller heben wollen, eine per Fallen gesicherte Goldtruhe.
Die kindlichen Traumata
Harris‘ Figuren eint kindliche Traumata, die sie als Erwachsene entweder zu Aufrechten gemacht haben oder zu Psychopathen. Hannibal Lecter musste miterleben, wie seine Schwester verspeist wurde; der transsexuelle Mörder Jame Gumb („Das Schweigen der Lämmer“) verzweifelte, weil ihm eine Geschlechtsumwandlung verwehrt blieb; Francis Dolarhydes („Roter Drache“) Großmutter drohte dem Jungen mit Kastration. FBI-Agentin Clarice Starling aber überwand das Geschrei der Tiere auf der Schlachtbank der elterlichen Farm, auch die Kindersoldatin Cari Mora ging gestärkt aus dem Krieg hervor.
Nun gerät Mora an Hans-Peter Schneider, einen Killer, den, wie auch Lecter, selbst Psychiater als „Monster“ bezeichnen. Der Deutsche will nicht nur das Gold, er verkauft auch Entführte oder deren Leichen(teile), wie Jame Gumb es plante, an reiche Perverse. Schneider hat einen „Zinkfinger“ und ist aufgrund eines Gendefekts haarlos, was aus ihm natürlich noch kein „Monster“ macht. Seine Lust am Töten aber bleibt im Dunkeln. Damit ist er der erste Harris-Schurke, der weniger interessant ist als die Heldenfigur. Mit dem Namen ist Nüchternheit beabsichtigt, aber deutschsprachige Leser könnten sich bei dessen Hobby, Tote in Säure aufzulösen, an Helge Schneiders „00 Schneider“-Aktionismus erinnert fühlen, wo Verbrecher ihren Job als Hauswirtschaft verstehen: „‘Hans-Peter räumt auf! Hans-Peter spült die Sorgen fort!‘, lautete sein Motto.“
Nicht alles an der Erzählung also überzeugt. Es gibt zu viele Nebenfiguren, vor allem auf Seite der Schurken. Schneiders Gehilfen tauchen ebenso schnell wieder auf, wie sie verschwinden bzw. sterben, auch die Truppe rund um Cari Moras vermeintlichem Helfer, Clan-Chef Don Ernesto, ist zu groß bestückt, um in Erinnerung zu bleiben. Die Escobar-Villa dient als Ablageplatz für Filmrequisiten, aber die Puppen rund um die Königin aus „Aliens“ sind als Schauer-Attrappen zwar von atmosphärischem, aber ohne erzählerischen Nutzen. Dazu kommt ein etwas altväterlicher Erzählton Harris‘, wann immer er Cari Mora in ihrem Alltag schildert. Sie lackiert sich – typisch Latino! – die Nägel im Bus und kontrolliert ihr Aussehen im Handspiegel; und sie sehnt sich auch, schreibt Harris, nach einer starken männlichen Schulter. Darin ist sie Clarice Starling nicht unähnlich.
Der Goldschatz immerhin ist das, was im Film „MacGuffin“ genannt werden würde: ein Sehnsuchtsobjekt ohne besonderen Nutzen, das aber die Handlung vorantreiben und die Charaktere miteinander verknüpfen soll. Harris hat Spaß daran, Schneiders Truppe und die Cari Moras sich wie Panzerknacker an den Sicherheitsmechanismen der Truhe – das Ticken wird immer lauter! – abarbeiten zu lassen. Doch liegen die Stärken seines Romans diesmal nicht in der Zuspitzung der Gewalt, Schatzsuche plus torture porn, sondern im Stillen. Cari Mora ist unfreiwillig Heldin, sie möchte nicht ins Visier der Einwanderungsbehörde geraten. Mit dem Gold würde sie ein bruchreifes Haus neu errichten, sich also eine amerikanische Existenz errichten.
13 Jahre liegt sein vorangegangener Roman „Hannibal Rising“ zurück, Thomas Harris ist 78. Vielleicht kommt kein weiteres Werk mehr. Viele hatten zuvor auf einen weiteren „Lecter“ gehofft. Aber sollen doch der Kannibale und seine Geliebte Starling weiter inkognito die Oper in Buenos Aires besuchen, wie am Ende von „Hannibal“. Dass die Ära Cari Moras anbricht, wirkt wie ein mutiger Neuanfang ihres Schöpfers. Harris ist gelassen geblieben, ein komplettes Kapitel lang widmet er sich einem unwesentlichen Krokodil, das auf den Golfplätzen Miamis auf Beutejagd nach Chihuahuas geht. Und das auch noch zum Roman-Finale. Er kann es sich leisten.
04. „Red Dragon“ (1981, deutsch: „Roter Drache“)
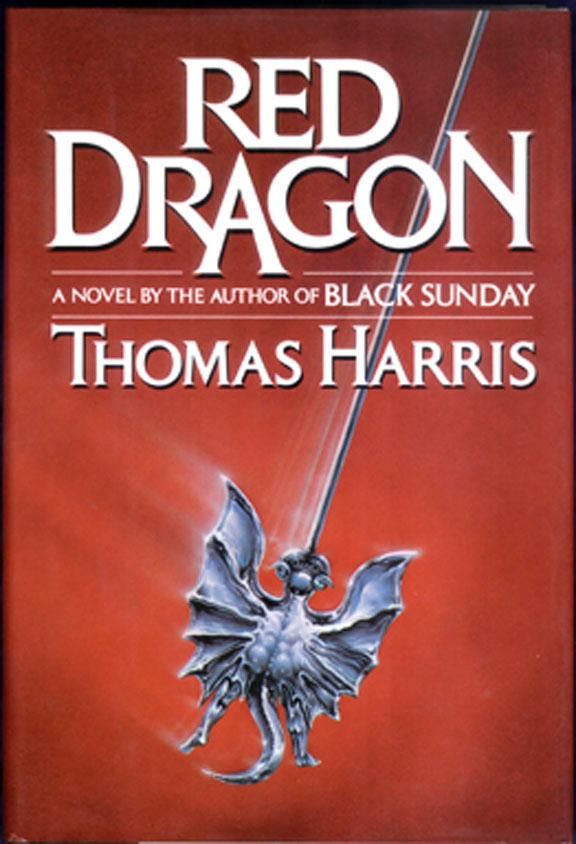
Lange nahmen wir selbstverständlich hin, was uns die Netflix-Serie „Mindhunter“ erst vor Augen führen musste: Dass unser Wissen über psychische gestörte Serienmörder langjähriger Arbeit von Profilern zugrundeliegt, die ihre Arbeit, überwiegend beim FBI, auch erst in den 1970er-Jahren wissenschaftlich systematisierten. Zuvor waren Killer „irre“ und „gestört“, aber ihre Psyche wurde nicht untersucht. Sie wurden halt weggesperrt oder landeten auf dem elektrischen Stuhl.
Für seinen zweiten Roman recherchierte Thomas Harris in der Abteilung für Verhaltenswissenschaft im FBI-Quartier in Quantico, Virginia, und widmete sich deren Forschungen über Serienmörder. Es inspirierte ihn zur Erfindung zweier Psychopathen, zwischen denen sein FBI-Profiler Will Graham wie ein Ping-Pong-Ball hin und her springen sollte, und von denen einer in die Literatur- und später in die Filmgeschichte eingegangen ist: Dr. Hannibal Lecter. Der Psychiater korrespondiert von seiner Gefängniszelle aus per Brief mit Francis Dolarhyde, dem zweiten Psychopathen, dem „Roten Drachen“.
Dolarhyde meuchelt in Vollmondnächten ganze Familien, beißt ihnen, einer Art Oralfixierung verschuldet, Körperteile ab, trägt oft das künstliche Gebiss seiner Großmutter und manchmal einen Kimono. Er spricht nie von Mord, sondern von Einverleibung und Absorbierung, er glaubt so, mehr zu sein, als er ist, und schenkt seinen Opfern damit vermeintlich die Veränderung ihrer unwürdigen Daseinsform.
AmazonWie vorsichtig Kinogänger zur damaligen Zeit an abnorme Menschen herangeführt werden, zeigten die ausführlichen Epiloge, denen sich die Regisseure Alfred Hitchcock und Brian de Palma der Innerlichkeit ihrer Figuren widmeten, 1960 wie 1980. Sowohl in „Psycho“, als auch – dem gelungenen Plagiat – „Dressed To Kill“ erklären Ärzte und Polizisten nach der Festnahme des Mörders, was die umgetrieben hat. Zuschauer sollten mit dem beruhigenden Gedanken den Saal verlassen, dass sie wissen, was den Mann von Nebenan zum sadistischen Killer mit Ödipuskomplex gemacht hat.
Schnipp, Schnapp, Pipi ab
Auch Dolarhyde wurde von einer Mutterfigur, hier der Großmutter, zum Psychopathen erzogen. Das „wie“ liest sich heute schematischer, als man es 1981 aufgefasst haben dürfte. Die Oma legte einst den Penis des Jungen zwischen die Scherenklingen und drohte mit Schnipp-Schnapp. Kastrationsangst, der Klassiker, um Kinder Angst einzujagen. Als Erwachsener sieht er die alte, längst verstorbene Frau nun überall, sogar in einem Porträt George Washingtons. Erlösung glaubt Dolarhyde in der Verwandlung in ein Fabeltier zu finden, dem „Roten Drachen“, inspiriert von William Blake und dessen Bild „The Great Red Dragon and the Woman Clothed with the Sun“.
Jungen lieben ihre Mutter, der kleine Francis sah gerne zu, wie sie an ihrem Schminktisch saß und ihr Makeup in einem jener Märchenspiegel begutachtete, die von zahlreichen Glühbirnen eingefaßt sind. Weil Dolarhyde, den Jungen mit der Sprachstörung, keiner wollte, landete er nun also bei der Großmutter, deren Haus ihn schnell befremdet, das eine „neue Welt darstellt, ein Wald aus blau geäderten Beinen.“
Die von Harris häufig skizzierten Paarkonstellationen sind soweit nicht von Dreigroschen-Romanen entfernt, die die Intensität, das „Feuer“ innerhalb der Liebesbeziehungen auch von Machtgefällen abhängig machen. Es gibt den Psychiater, der für seine Schülerin den Vaterersatz darstellt (Hannibal Lecter und Clarice Starling), es gibt den Schüler, der die weit ältere exotische Lehrerin begehrt (Hannibal Lecter und Lady Murasaki).
Im „Roten Drachen“ – und diese Liebe schrammt haarscharf am Erlöser-Kitsch vorbei – erkennt die junge Reba unvermittelt Schönheit im Arbeitskollegen Dolarhyde. Der traut sich in seiner bürgerlichen Existenz als Fotolabor-Entwickler kaum zu sprechen, weil er sich für seine Lippen-Kiefer-Gaumenspalte schämt. Reba ist blind, sie sieht ihn nicht. Sie überlebt die Beziehung zum Serienmörder, sie hat die guten Seiten seines Wesens zum Vorschein gebracht, er konnte ihr einfach nichts antun.
„Zahnschwuchtel“
Die deutsche Übersetzung hat aus Dolarhydes von der Klatschpresse aus der Taufe gehobenen Beinamen „Tooth Fairy“, er ist ja ein Beißer, nicht die „Zahnfee“ gemacht, sondern die „Zahnschwuchtel“. Das würde heute wahrscheinlich, zum Glück, nicht mehr passieren. Der „Vorwurf“ homosexuell zu sein, ist dennoch ein großes Thema der Geschichte. Dolarhyde ist gekränkt, wenn er als schwul bezeichnet wird, so sehr, dass er einen Reporter tötet. Ein Polizeiarzt spricht von einer unterschwellig homosexuellen Konfliktsituation, also der Angst davor schwul zu sein. Nur deshalb habe Dolarhyde auch einem von ihm getöteten Mann danach die Unterhose wieder angezogen.
Diese Psychologisierung ist umso schauerlicher, da sie der Weltanschauung des zweiten Antagonisten, Hannibal Lecter, gegenübergestellt wird. Der lässt sich gerne als „Monster“ bezeichnen, weil er davon überzeugt ist, dass man als Monster geboren werden kann. „Wir schaffen uns unsere Persönlichkeit nicht“, sagt er zum Ermittler Will Graham. „Sie wird uns mit unserer Lunge, unserer Bauchspeicheldrüse und allem anderen bereits in die Wiege gelegt. Weshalb also dagegen ankämpfen?“ Damit verwirft Lecter mögliche Ursachen für Dolarhydes psychosexuelle Entwicklung, die Kastrationsangst, den Ödipuskomplex. Die „Zahnschwuchtel“ wäre so unter jeder Bedingung zur Bestie geworden. Er ist Vertreter einer Schicksalslehre, die allen FBI-Profilern Hohn spricht.
Hannibal Lecter beansprucht im „Red Dragon“ auch den schockierendsten Moment für sich. Es gelingt ihm, eine codierte Nachricht aus seiner Zelle an den Bewunderer Francis Dolarhyde zu übermitteln. Es ist ein Mordauftrag, um den gemeinsamen Gegner aus dem Weg zu schaffen, und dessen Familie gleich mit. Lecter muss nicht immer Reden schwingen, die Botschaft, in der er eine Geheimadresse verrät, lautet: „Graham Zuhause Marathon. Florida. Rette dich. Alle umbringen.“
03. Hannibal Rising (2003)
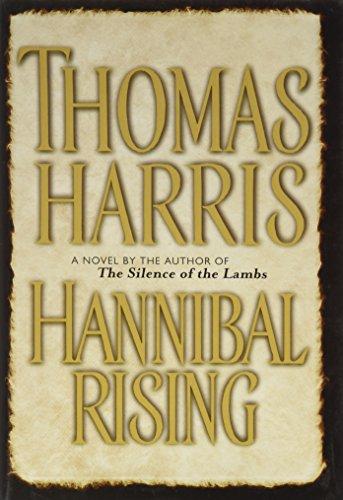
Der Legende nach hat Thomas Harris das finale Lecter-Buch nur geschrieben, weil Hollywood-Produzent Dino de Laurentiis Druck gemacht hatte. Ein Film über die Kindheit und Jugend des Kannibalen komme definitiv, es liege an Harris, ob er zuvor eine Romanvorlage schreiben wolle. Entstanden ist also quasi eine Selbstauftrags-Arbeit, dann Harris wollte sich natürlich nicht die Butter vorm Brot nehmen lassen. Hannibal gehörte ja ihm.
Für „Hannibal Rising“ erhielt er erstmals durchwachsene Kritiken. Es gab solche Leser, die die Anfangsgeschichte des genialen Kannibalen erfahren wollten, andere hätten es schöner gefunden, die Genese des Bösen wäre im Dunkeln geblieben. Dass Hannibal als Junge den Mord an seiner kleinen Schwester Mischa zu betrauern hatte, wurde bereits im Vorgänger-Roman „Hannibal“ angedeutet.
Natürlich ist die Romanze zwischen dem ergebenen Teenager Hannibal und der älteren, vornehmen Witwe seines Onkels, der Japanerin Lady Murasaki, der Stoff, aus dem die Seifenopern sind. Es ist eine unmögliche, eine unwahrscheinliche Liebe. Allein dieser Satz wäre jedem anderen Autoren seiner Größe um die Ohren gehauen worden: „Was ist noch übrig in dir, das ich lieben könnte?“. Das sagte die Lady verzweifelt und „lief aus der Kabine und die Kajütentreppe hinauf und hechtete in einem perfekten Kopfsprung über die Reling in den Kanal.“ Was für ein dramatischer Abgang! Bücher aber sollten Fernsehen inspirieren, nicht umgekehrt, hier aber gibt es tatsächlich Szenen, die wie aus einem Sonntagabend-Melodram übernommen zu sein scheinen. Vielleicht hatte Harris den Film schon im Kopf, verübeln konnte man es nicht, saß ihm doch der Hollywood-Produzent im Nacken.
Hannibal, der Rächer
Als sich Hannibal der neuen Ziehmutter erstmals nähert, sieht er es: „Die flüchtige Bewegung eines Vorhangs hinter jenem Fenster im Obergeschoss, der Glanz von Lady Murasakis Haar, dann ihre Silhouette.“ Vor Kitsch war Harris früher schon nicht gefeit, die Beziehung der blinden Reba zum „Monster“ Francis Dolarhyde im „Red Dragon“ war auch die des Paars größtmöglicher Gegensätzlichkeit.
„Hannibal Rising“ entwickelt sich gleichermaßen zu einem Kriminalroman: Können dem klugen Jungen diverse Morde nachgewiesen werden?, wie zu einem Rächer-Roman – er will Jahre später die Mörder seiner Familie aufspüren. Das ist bisweilen durchaus schematisch. Denn die Polizei muss, immer einen Schritt hinter Lecter hinterher, Indizien zusammentragen, die der Leser längst kennt. Und das Ende scheint auch klar. Natürlich wird Hannibal die Nazi-Kollaborateure kalt machen.
Und dennoch: Thomas Harris ist eine berührende, verstörende, schockierende, epische Erzählung gelungen, und das im in der deutschen Übersetzung schmalen Umfang von 335 Seiten. „Hannibal Rising“ beginnt geradezu gigantisch. Es ist der erste Teil dieser Geschichte, in der Harris zu überragender Form aufläuft. Schicksalhafte Jahre einer Kindheit, verdichtet in präzisen Sätzen auf gerade mal 100 Seiten. Der Überlebenskampf der Lecter-Kinder im litauischen Winter des Zweiten Weltkriegs von 1941. Hannibal und Mischa verstecken sich in der Waldhütte der Eltern und werden dort von fünf Deserteuren entdeckt, denen bald die Vorräte ausgehen. Diese fünf sind Menschen, die Kadaver von den Ketten ihres Panzers abkratzen um sie dann zu essen. So weit hat sie der Hunger getrieben. Es wird dann die kleine Mischa sein, die sie verzehren, bevor sie sich Hannibal widmen wollen.
Der Tod der Schwester, die Hilflosigkeit des Jungen gegenüber den Erwachsenen, das wird Hannibal Lecter umtreiben. Der voran gegangene Mord an den Eltern – sie werden von einer Fliegerbombe getroffen – zeigt noch, wie kontrolliert das Kind ist, wie es sich augenblicklich auf neue Lebensumstände einrichten kann. Die Zeit schreitet voran, alles macht weiter, was Harris zu einem seiner schönsten Sätze inspirierte. Hannibal nähert sich der Leiche seiner Mutter: „Er holte eine Serviette aus dem Haus und legte sie auf ihr Gesicht. Nach und nach begann sich Schnee darauf zu häufen.“
Die NS-Verbrecher im Blick
Panzer, Maschinengewehre, Stukas, Wehrmacht, Winter, Nazis, Nazi-Kollaborateure, nach Ende des Zweiten Weltkriegs dann von Frankreich aus die Suche nach den gestohlenen Kunstschätzen der Lecter-Familie, die die fünf Deserteure und Mörder reich gemacht haben – das ist ein klasse Stoff für einen Pulp-Thriller. Selbst von Frankreich aus behält Lecter die NS-Verbrecher im Blick, die es eben nicht nur im Deutschen Reich gab oder an der Ostfront, sondern auch im Westen. Einen Pariser Inspektor konfrontiert er damit, den Gestapo-Chef von Lyon, Klaus Barbie, nicht gestoppt zu haben.
Wer hätte nach dem „Roten Drachen“ von 1981 gedacht, welch aufregende Biografie dieser Psychiater gehabt hat? Ärzte, Erzieher und Kommissare arbeiten sich an der Psyche des Jugendlichen ab, und sie stoßen doch nie zu seinem Innersten hervor. Die meisten ziehen immerhin die richtige Verbindung zwischen der Hilflosigkeit beim Mord an seiner Schwester und der zunehmenden Gefühlskälte mit fortschreitendem Alter. Hannibal wird fortan, wie schon in den drei voran gegangenen Hannibal-Romanen, als „Monster“ bezeichnet.
Er selbst betet später an der Stelle, wo Mischa ihr Leben ließ, und findet Trost in seinem Atheismus, dem Wissen, dass es keinen Gott und keinen Himmel gibt, dem sie sich andienen müsse. Er sagt ins Grab, dass sie ihm jeden Tag fehle. Etwas Intimeres würde Hannibal nie mehr sagen.
Am Ende, er wurde von Lady Murasaki verlassen, begibt er sich in die Einsamkeit, und er ist glücklich damit. „Hannibal war in den langen Winter seines Herzens eingetreten.“