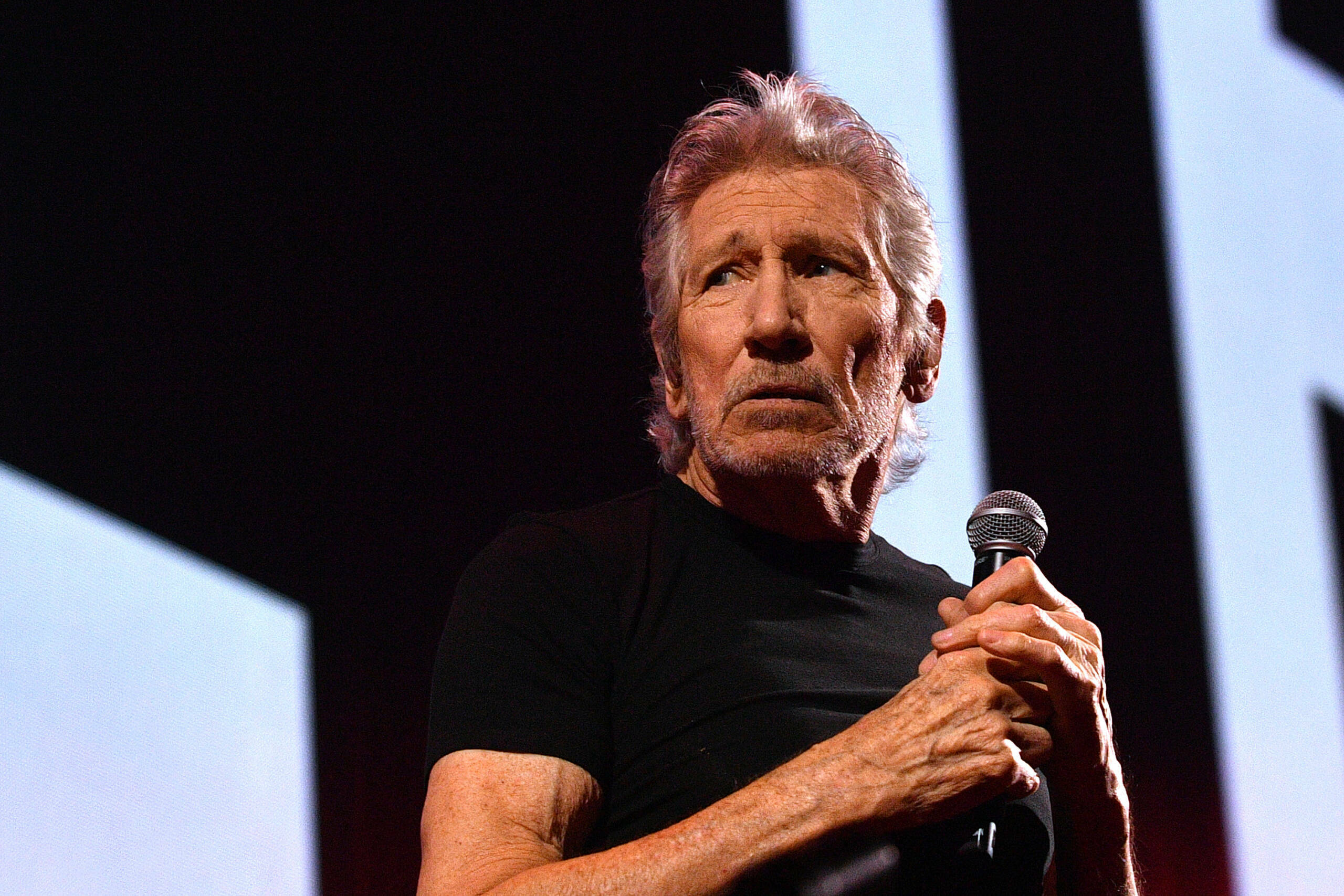Niemand konnte schnell genug auf David Bowie reagieren, und gerade Journalisten kann das Versagen, eine bedeutsame Ankündigung nicht mal ansatzweise zeitgleich gebracht zu haben, richtig weh tun. So, wie diese Worte, die nicht verletzend gemeint waren, eher unser aller Verzweiflung ausdrückten: „Warum steht auf unserer Startseite jetzt ausgerechnet ein historischer Abriss zu seiner Party 1997, als er seinen 50. Geburtstag feierte? Und nicht das eigentlich wichtige Ereignis?“. Das fragte der ROLLING-STONE-Chefredakteur in die Runde.
Es war der 08. Januar 2013. Nicht, dass Bowies 1997er-„Birthday Bash“ im Madison Square Garden keinen Anlass für eine Erinnerungsstory auf unserer Homepage bot. Aber der 08. Januar 2013, der Geburtstag David Bowies, jener Tag der Aufregung, lieferte eine Story, die viel größer war. Da war die Nachricht, da war das Video noch keine drei Minuten alt. Und die Welt eilte dem nun hinterher.
Er war zurück. Und keiner, der nicht bei ihm im Studio war, keiner, der nicht zum inneren Kreis seiner Familie und seines Labels gehörte, hatte das gewusst. Es gab kein Briefing. Strengste Geheimhaltung im Netzzeitalter. Bowie hatte das Internet besiegt.
Bowie kehrt zurück – geheim und überwältigend
„Where Are We Now?“ hieß die ohne Ankündigung auf YouTube veröffentlichte Comeback-Single, und dass sie gerade hierzulande so innig geliebt werden würde, offenbarte sich nach 20 Sekunden, in der zweiten Songzeile: „Had to get the train, from Potsdamer Platz“. Er sang über Berlin.
Fast zehn Jahre fehlte David Bowie der Musikwelt. Keine Alben. Keine Tournee. Er gab auch keine Interviews. Man wusste nicht, wie es ihm geht – neun Jahre nach einem Herzinfarkt, der ihm fast das Leben gekostet hätte. Man wusste auch nicht, wie er auf seine eigene Arbeit blickte, ob er überhaupt noch Lust hatte, an der eigenen Legende zu stricken. An welche Zeit er gern zurückdachte.
Nun wusste man es. Seine Rückkehr handelte von jener Zeit, von der niemand ahnte, dass sie seine liebste war: sein Leben in West-Berlin 1977 und 1978. Eine Hochphase des Kalten Kriegs, mit einer geteilten Stadt, die sich im Auge jenes atomaren Sturms befand, den die Blockmächte zu entfachen drohten.
West-Berlin als Sehnsuchtsort
Bowie war der einzige ausländische Superstar, der in jenen Jahren im Glamour-befreiten West-Berlin lebte (sein Freund Iggy Pop folgte später nach Schöneberg, aber als Sänger der längst aufgelösten Stooges war er fast in Vergessenheit geraten). Seit Berlin wurde Bowie oft sesshaft. Er kannte zuvor schon London, natürlich, New York, Los Angeles, später die Bahamas und Barbados. Aber es war Berlin, das Wehmut in ihm weckte. Das hat die Stadt ihm nie vergessen. Hätte er je davon singen können, wie er beseelt die Straßen von L.A. entlang spaziert – jene Metropole, vor der er sich im Kokainwahn derart fürchtete, dass er so gut wie nie aus seiner Limousine ausstieg?
In „Where Are We Now?“ zeichnet er das alte West-Berlin nach: „Dschungel“ (die Diskothek), „Nürnberger Straße“, „KaDeWe“, dazu die „Bösebrücke“, die beide Stadtteile verband. Wer alt genug war, erinnerte sich auch dank der in Song-Form gegossenen Schwelgerei dieses Briten an eine morbid-faszinierende Ära in Grautönen zurück, die durch „Christiane F.“ und Bowies Soundtrack-Beiträgen geprägt war.
„Where Are We Now?“ wollte das Wo-wir-jetzt-stehen aber gar nicht beantworten. Es war ein Innehalten. Die Freude, zu leben: „As long as there’s me / as long as there’s you.“
„The Next Day“ – das neue Kapitel
Zwei Monate nach dem balladesken „Where Are We Now?“ veröffentlichte David Bowie sein 25. Studioalbum: „The Next Day“. Der an dröge Arbeitsroutinen erinnernde Plattentitel schien neugierige Hörer zu verhöhnen: Ja, Bowie schlägt einfach so neues Kapitel auf, ohne Verweis auf seine Nahtoderfahrung, die Rekonvaleszenz. Das Cover wiederum entsprang einer genialen Idee. Bowie entschied sich für das „Heroes“-Motiv, auf dem nun ein weißes Quadrat mit dem Albumtitel in schwarzer Doctrine-Schrift sein Gesicht verdeckt und eine Linie den ursprünglichen Albumtitel durchstreicht. Gleichzeitig Überschreibung wie Fortsetzung also eines der meistgeschätzten Bowie-Alben.
„The Next Day“ gelang in Deutschland und im UK auf die Eins, in den USA auf die 2. Im Jahr des Disco-Retro-Trends von Daft Punk und „Get Lucky“ erschien dieses Gitarre-Bass-Drums-Album fast schon anachronistisch. Es war sein bestes seit „Let’s Dance“ aus dem Jahr 1983, und, von seiner Leadsingle abgesehen, keine Memory-Lane-Arbeit, kein „Schulterblick eines Überlebenden“. Die Songs behandeln die Jetztzeit, die Welt, die wir unseren Kindern hinterlassen: religiöser Fundamentalismus („The Next Day“), Schulmassaker („Valentine’s Day“) und junge Menschen als Kanonenfutter („I‘d Rather Be High“).
Der militärisch-stoische Schlagzeug-Rhythmus von „You Feel So Lonely You Could Die“ mag noch an den „Ziggy Stardust“-Klassiker „Five Years“ erinnern; „If You Can See me“ enthält eine kokette Selbsteinschätzung, auf die eine verblüffende Offenbarung folgt: „Now you can say I’ve got a gift of sorts / A fear of rear windows and swinging doors“. Es sind jedoch höchstens die B-Seiten, wie „Born in an UFO“, die auf eigenen Werdegang und Kollegen verwiesen. Sie dienen auch der Abgrenzung: Springsteen ist terrestrisch, Bowie extraterrestrisch. Gemeinsam haben beide, dass sie in ihren Songs die fast schon ausgestorbene Kunst des Fade-Outs, anstelle einer Kadenz, perfektionierten.
Bilder, Predigten – aber keine Tour
In den Musikvideos zeigte Bowie sich als verstörter Bewohner eines Spukhauses, als Prediger, und er zielte mit einem imaginären Gewehr in die Kamera.
Ja, er war wieder da. „Ich freue mich schon“, sagte sein Produzent Tony Visconti, „diese Songs live zu hören“.
„Werden wir nicht“, antwortete Bowie.
Warum nicht?
Der Bruch: Das Ende der Bühne 2004
Dafür muss man fast zehn Jahre zurückgehen. Der 25. Juni 2004 sollte Bowies Leben, geprägt durch Alben im Maximal-Dreijahres-Takt und stete Tourneepräsenz, schlagartig verändern. Auf der Bühne des Hurricane-Festivals bekam er Brustschmerzen. Noch in derselben Nacht wurde er in Hamburg notoperiert. Zuvor brach er sein Konzert in Prag ab, nach dem 16. Song, der, bittere Ironie, den Titel „Changes“ trägt. Im Netz sind Aufnahmen davon, sie sind schwer zu ertragen. Bei „The Man Who Sold The World“ sitzt Bowie bereits auf einem Hocker, statt wie üblich zu stehen. Er fasst sich an die Brust, lächelt gequält, muntert das Publikum auf: „How you’re doing, mate?“. Dann: „Die Schmerzen sind zu groß. Es tut mir wirklich leid.“ Er tritt ab.
Die „Reality“-Tournee 2003-2004 markierte das Ende einer ersten Renaissance David Bowies. In den 1990er-Jahren erarbeitete er sich den Respekt zurück, den er in den 1980ern, der von ihm „Phil-Collins-Ära“ getauften Zeit, seiner Ansicht nach verloren hatte. Er durchpflügte nun Trends, wie er es zuletzt in seiner Hochphase der 1970er tat. Er nahm Neo-Bop mit Nile Rodgers auf, danach Industrial, Drum’n’Bass, und veröffentlichte Lieder über das noch junge Internet.
Renaissance und radikale Setlists
Es würde jedoch die Rückkehr Tony Viscontis, seines kongenialen Partners aus „Space Oddity“- und „Berlin-Trilogie“-Zeiten, sein, die die Wahrnehmung Bowies für das neue Jahrtausend prägen sollte. Visconti richtete alle vier letzten Studioalben ein. Bowie wollte nur noch ihn.
Er war jetzt ein Legacy-Künstler, der im Dreiteiler auf der Bühne stand, und dessen Haar durch eine Windmaschine in „Cabrio-Flattern“ (wie Frank Schätzing in seinem jüngst erschienenen Bowie-Buch „Spaceboy“ schreibt) versetzt wurde. Das ZDF zeigte einen Berlin-Zusammenschnitt der „Heathen“-Tournee von 2002, bei dem Bowie an manchen Abenden sein „Low“-Album („Weeping Wall“ wie immer ausgenommen) auf analogen Instrumenten des Jahres 1977 aufführte – wie auch bei jenem fürs Fernsehen aufgezeichneten Gig in der Max-Schmeling-Halle. Es war der Sonntag der Bundestagswahl, Schröder gegen Stoiber, die dieser König selbstverständlich nicht eines einzigen Kommentars würdigen sollte.
Ein seltsam nahbarer König dennoch: Er tingelte Anfang der Nullerjahre für die Promo auch durch Radiosender und gab Stadtmagazinen Interviews. Denn würde er für „Heathen“ 2002 und „Reality“ 2003 einige seiner besten Kritiken enthalten – Hits waren sie dennoch nicht. Experimentell auch nicht. Schlager wie „Everyone Says Hi“ oder „Never Get Old“, flankiert durch dessen Einsatz in einer Mineralwasser-Werbung, übertrafen in sich versunkene High-Art-Stücke wie „The Rays“ oder „Bring Me The Disco King“. Diese zwei Alben wirkten ziellos.
Zwiespalt der Nullerjahre
Anders die Tourneen. Die „Heathen“- und die „Reality“-Konzertreisen waren unvergesslich. Backkatalog von vorne bis hinten. Ein Ironiker war Bowie schon immer, aber nie zuvor ging er derart gnadenlos mit seiner Diskographie ins Gericht. Ein Abend nur mit Ansagen, ohne Lieder, wäre nicht minder großartig gewesen. „Der nächste Song heißt ‚Let’s Dance‘. Mmmmmm, die Eighties!“, sagte er, scheinbar schwärmerisch. Oder: „Jetzt kommt ‚I’m afraid of Americans‘, ein Stück aus den Neunzigern, das also“ – und er zeigte mit dem Finger auf mehrere Stellen im Publikum – „genau 2,3,4 Leute kennen.“ Zu Beginn von „Ziggy Stardust“ ahmte er die Glam-Fanboys der Siebziger nach, die ihm den Abschied von der Kunstfigur nie verziehen haben. Bowie hielt sich theatralisch die Hände an die Wangen: „Why did you kill Ziggy!“.
Momente wie diese sind festgehalten auf dem neuen Ära-Boxset „I Can’t Give Everything Away (2002-2016)“, in den Mitschnitten aus Montreux und Dublin. Darauf zu hören ist auch Mike Garson, 80, einer der wichtigsten Mitstreiter Bowies. Seine Spuren finden sich auf zehn Studioalben ab 1973, zuletzt auf „Reality“. Die berühmten atonalen Klavierläufe auf „The Hearts Filthy Lesson“ stammen auch von ihm, ebenso die rhythmischen Brechungen auf „Lady Grinning Soul“.
„Er hasste L.A., hasste es noch Jahrzehnte nach seinem Wegzug“
Im Interview (ausführlich zu lesen auf rollingstone.de) streitet er nicht ab, dass der „Tod“ Ziggy Stardusts vielleicht durch sein avantgardistisches Spiel eingeleitet wurde. Als Garson die Spiders from Mars ab 1973 als Pianist begleitete, verlor Bowie die Lust am immer abgeschmackter klingenden Glam. „Ich brachte ihm all die amerikanischen Einflüsse nahe. Jazz, Rhythm and Blues, Black Music.“ Indirekt, sagt er, gab er Bowie damit die Lizenz zum Überleben als Künstler. „Aber ich möchte meine Rolle nicht überbetonen. Ich war das: der Pianist für einen Sänger.“
Bis zu seinem Tod blieben sie befreundet. „Ich denke täglich an David“, sagt Garson. „Ich hätte auch gern auf ‚The Next Day‘ und ‚Blackstar‘ mitgewirkt. Ich höre beide Alben und weiß genau, was ich darauf gemacht hätte. Ich glaube sogar, mein Klavierspiel hätte beide Alben noch besser gemacht. Aber was soll ich sagen? Er wollte nicht raus aus seinem Studio in New York, ich nicht aus Los Angeles.“ Garson sagt lachend: „Er hasste L.A., hasste es noch Jahrzehnte nach seinem Wegzug. Er hasste die Stadt und ließ es an mir aus, weil ich hier lebte.“
Kein Tour-Comeback – und warum
Als Tony Visconti sich 2013 die Abfuhr Bowies für eine „The Next Day“-Tournee abholte, lag das vielleicht auch an einem Gespräch, das Bowie Jahre vorher mit Garson geführt hatte. Oder, drastisch formuliert: Mike Garson ist schuld, dass Bowie nicht mit dem Material seiner zwei letzten Alben auf Tournee gegangen ist. Dabei wollte Garson nur das Beste für seinen Freund. „Mir ist wichtig, das klarzustellen. Er hat mich um meinen Rat gefragt“, sagt er. „Er hätte mich nicht fragen brauchen. Er fragte mich: ‚Sollen wir nochmal auf Konzertreise gehen?‘ Ich sagte: ‚Nur, wenn Du dich wirklich danach fühlst.‘ Und er fühlte sich nicht danach. Ich konnte in seiner Stimme auch hören, dass er sich schlecht fühlte, weil seine Band keine Arbeit hat.“
Bowies Herzinfarkt mag das Studio- und Bühnenleben für viele Jahre beendet haben, gänzlich abgetaucht aber war Bowie nach dem Tourneeabbruch ab Prag 2004 nicht. Er veröffentlichte schon ein Jahr später ein Lied, eine befristete Rückkehr, die zum Glück keiner mitbekam: das alberne Electronica-Stück „(She Can) Do That“ in Zusammenarbeit mit dem Produzenten BT, für einen Film, den keiner kennt, „Stealth“. Ebenfalls 2005 trat er wieder auf, wenn auch nicht mehr für ein ganzes, eigenes Konzert.
Nach dem Herzinfarkt
Er sang in der Radio City Music Hall drei Lieder mit Arcade Fire, und hier wurde erstmals gewahr, was die Restitution zumindest mit seinem Äußeren machte. Er war schlank, aber sein Gesicht war aufgequollen, und seine Stimme klang gepresst. Nach dem 29. Mai 2006 verabschiedete Bowie sich schlussendlich vom Konzertleben. Bei einem Auftritt seines Freundes David Gilmour in der Royal Albert Hall sang er die Pink-Floyd-Klassiker „Arnold Layne“ und „Comfortably Numb“.
Im Kino und Fernsehen war Bowie noch einige Male zu sehen und zu hören, und das stets auf beeindruckende Weise. Etwa In Ricky Gervais‘ Comedy-Serie „Extras“, kurz nach seinem Herzinfarkt. Er setzte er sich ans Klavier und unterhielt eine Kneipengesellschaft mit einem gegen Gervais gerichteten Spottlied. Gervais sitzt neben ihm und muss ertragen, wie Bowie ihn mustert und sich die Worte zufliegen lässt: „Pug Nosed Face“ – die melodische Vorlage von „Where Are We Now?“.
Zwitter aus Rolle und Realität
Aber es ist Bowies Auftritt in einem Christopher-Nolan-Film, der nicht nur als Rollendarstellung, sondern als spektakuläre Hommage an ihn selbst funktioniert. In „The Prestige“ verkörpert er den Elektrizitätspionier Nikola Tesla – und lässt sich als Rockstar mit gigantischem Auftritt inszenieren. Tesla marschiert über eine Bühne auf einen verblüfften Show-Zauberer zu, über ihm Blitze, die aus einer (Disco-)Kugel strömen. Ein Ziggy aus der Zeit des viktorianischen Englands.
Das war 2006, und Bowie war noch lange nicht bereit für ein neues Album. Erst als er mit „The Next Day“ zurückkam, sieben Jahre später an seine größten Chart-Erfolge anknüpfte, schien alles wieder beim Alten zu sein. Bowie war 66 und sah, wenn auch rundlicher, doch zumindest gesund aus, gut fünf Jahre jünger für sein Alter. Bereit für die nächste Runde also – die schon im November 2015 eingeleitet wurde.
Denn mit „Blackstar“ wurde eine neue Single angekündigt. Dazu das gleichnamige Album. Mit 9:57 Minuten Spieldauer würde „Blackstar“ seine längste Single sein. Ein von Fackeltempelgesängen getragenes Epos, das sich in der Song-Mitte in eine von Streichern getragene, an den Himmel gerichtete Partitur verwandelt. Bowie demonstrierte aber auch Geschäftssinn und Chart-Hunger: „Blackstar“ war nicht länger als 10 Minuten, damit es auf iTunes zum Kauf angeboten werden durfte.
„Blackstar“: Letzter Aufbruch
Laut Pressemitteilung würde das „Blackstar“-Album nur sieben Stücke enthalten. In Ordnung! Hauptsache, Bowie war gekommen, um zu bleiben.
Der nun wieder gewohnte Dreijahres-Rhythmus der Bowie-Studioalben stimmte euphorisch. Der traurige Hintergrund dieser beschleunigten Produktivität war niemandem, der am 08. Januar 2016, David Bowies 69. Geburtstag, „Blackstar“ in den Händen hielt, klar.
Zwei Tage später dürften bei unzähligen Bowie-Fans über die Messenger-Programme von Social-Media-Freunden diese zwei Worte eingetrudelt sein: „David Bowie“. Mehr braucht es bei solchen Mitteilungen heutzutage nicht, um sofort den Rechner aus dem Ruhemodus zu holen. Die offizielle Meldung stand bei Facebook zuerst. Bowie erschien wie sein eigener Vollstrecker und PR-Manager. Außerhalb seines engsten Kreises wusste keiner, dass er an Leberkrebs litt. Das Timing, man muss es so sagen, war perfekt.
Der 10. Januar 2016
Auf Facebook, zur besten Frühstückszeit: „David Bowie died peacefully today surrounded by his family after a courageous 18 month battle with cancer. While many of you will share in this loss, we ask that you respect the family’s privacy during their time of grief.“
Ein bemerkenswertes Statement – wegen des ersten Satzes. Der zweite ist Standard beim Tode Prominenter, so will man sich die Meute vom Hals halten. Satz eins bot den Schock. Aber nicht allein wegen der reinen Nachricht, „died peacefully today“. Schlimm erschien auch „after a courageous battle“. Man hatte ihm den Kampf nicht angesehen. Und dann auch noch über einen Zeitraum von 18 Monaten? In diese Zeit fielen immerhin Dreharbeiten zu den „Blackstar“-Musikvideos, in denen er die Hauptrolle spielte.
Darunter in „Lazarus“, in dem Bowie einen Todgeweihten verkörperte: „Look up here, I’m in heaven“. Aber kein Hörer, der „Blackstar“ in diesen 48 Stunden zwischen Veröffentlichung und der Todesnachricht hörte, hätte den Zusammenhang zum echten Leben ziehen können. Für 48 Stunden war „Blackstar“ einfach eine sehr gute Platte. Nach dem 10. Januar 2016 wurde diese sehr gute Platte zu einem Vermächtnis.
Vermächtnis statt Comeback
„Blackstar“ ist vielleicht nicht besser, aber sicher mutiger als „The Next Day“. Bowie verabschiedete sich von der klassischen Strophe-Refrain-Struktur und den Geschichten über Fremde. Er berichtete von Erinnerungen aus allen Phasen seines Lebens, bis hin zu Widmungen an die größte Liebe seines Lebens, wohl nicht Iman, sondern seine Muse aus den 1960ern, Hermione Farthingale, und zwar im Titelsong.
In „Dollar Days“ wiederum singt Bowie „If I’ll never see the English evergreens, I’m running to / It’s nothing to me“. Er sah sich stets als Filmstar, der er doch nie sein konnte und hat nun seinen Frieden damit geschlossen. „Dollar Days“ schließt auch den Kreis zu seinem 1977er-Song „The Secret Life of Arabia“, einer Valentino-Fantasie: „You must see the movie, the sand in my eyes / I walk through a desert song when the heroine dies“.
Das vielleicht schönste Lied des Albums erwartet uns jedoch am Schluss: „I Can’t Give Everything Away“. Bowie spielt darin die Mundharmonika-Melodie eines anderen, eigenen Stückes von 1977 nach: „A New Career in a New Town“. Beide Songs vereint bieten eine perfekte Definition Bowies. Er bricht auf zu einem neuen Ort, fängt dort bei Null an, und die Menschen, die er dafür verließ, hatten ihn nie recht begriffen – er konnte für sie ja „nicht alles hergeben.“
Nachleben im Katalog
Dafür gibt die Plattenfirma für ihn alles. In den vergangenen zehn Jahren, seit seinem Tod, hat sie mehr seiner Lieder (wieder-)veröffentlicht, als Bowie in den zehn Jahren davor, als sein Tod nicht absehbar war, selbst herausbrachte.
Für die „Blackstar“-Aufnahmen stellte er eine neue Band zusammen, verzichtete also auf die Hilfe von Weggefährten wie Gail Ann Dorsey, Sterling Campbell, Earl Slick und Gerry Leonard. Sein Jazz-Quartett, das in anti-symphonischen Symphonien wie „‘Tis a Pity She Was a Whore“ zu rasender Höchstform aufläuft, wurde vom Saxofonisten Donny McCaslin angeführt, begleitet von Schlagzeuger Mark Guiliana, Pianist Jason Lindner und Bassist Tim Lefebvre. Man darf vermuten: Wer sich ausgerechnet mit Jazz und Art-Rock statt, zum Beispiel, sanfter New Age, in den eigenen Tod begleiten lässt, hat alle wichtigen Dinge mit dem Leben bereits geklärt.
Frank Schätzing schreibt, dass Bowie 2016 dasselbe gelang, wie mit seiner Kunstfigur Ziggy rund 40 Jahre zuvor: den eigenen Tod in einen Mythos umzudeuten. Nun war es so weit – und es würde am eigenen Leib stattfinden. „Jesus am Kreuz lässt grüßen. Unausweichlich müssen Messiasse sterben, erst durch ihr gewaltsames Ableben erlangt ihre Verkündung Gewicht.“
Damit widerlaufe Bowie auch dem „Longetivity“-Trend der immer mächtiger werdenden Tech-Bros: „Mit schönem Gruß ins Silicon Valley, wo sie wie besessen am ewigen Leben werkeln. Unsterblichkeit zu erringen, erfordert zu sterben.“ Für „Blackstar“ erhielt Bowie posthum den „Brit Award“ für das Album des Jahres, erstmals, und vier Grammys, darunter für das „Best Alternative Music Album“ – sein erster Album-Grammy überhaupt.
Rätsel, Preise, Unsterblichkeit
Am Ende blickte Bowie dem Tod ins Gesicht, aber nicht, indem er dem Tod seine Karriere als Schutzschild entgegenhielt. Kein „Sieh, was ich geleistet habe! Den Starman, dann ein Leben in Berlin, dort, wo kein britischer Popstar leben wollte …“ Bowie verabschiedete sich vielmehr mit Rätseln. Sowohl in seinen Songs als auch auf dem „Blackstar“-Albumcover. Und wer sich mit Rätseln verabschiedet, sucht nicht zwangsläufig Frieden mit der Nachwelt, geschweige denn mit seinen Jüngern. Rätsel sind dazu da, gelöst zu werden. Wer sie lösen will, aber das nicht schafft, ist enttäuscht. Irgendwann vielleicht auch wütend auf den Künstler, der klüger sein will als man selbst.
Dieses Risko einer Entfremdung ist Bowie eingegangen. Allein, wie viele Menschen sich auf die Suche begeben haben, auf der LP-Hülle oder in den CD-Booklets von „Blackstar“ die Mysterien aufzuklären, die sich in den Anordnungen von Sternen und anderen Zeichen, die das Album zieren, verbergen sollen. Rund 20 dieser Rätsel sind schon gelöst. Je nach Lichteinfall auf Pappe oder Papier sollen noch andere Mitteilungen Bowies zum Vorschein kommen. Daran arbeiten sich die Leute noch immer ab. Es ist, als hätte der Mann nie geplant zu gehen.
Erst im September dieses Jahres wurde bekannt, dass Bowie seine letzten Monate mit der Arbeit an einem neuen Projekt verbrachte. Handschriftliche Notizen umrissen ein „Musical aus dem 18. Jahrhundert“ mit dem Titel „The Spectator“. Selbst seine engsten Mitarbeiter wussten nichts von der Existenz des Projekts, bis die Notizen 2016 in seinem Arbeitszimmer gefunden wurden. Die Aufzeichnungen spiegeln Bowies Interesse an Entwicklung von Kunst und Literatur im London des 18. Jahrhunderts wider, besonders an Geschichten über kriminelle Banden und den Dieb „Honest” Jack Sheppard.
Das geheime Projekt: „The Spectator“
Historie war seine geheime Leidenschaft – aber wie hätte David Bowie wohl auf die Welt von heute geblickt? Er, oder die im selben Jahr verstorbenen Prince und George Michael? Im „Blackstar“-Jahr 2016 war Trump schon gewählt, aber AfD-Aufstieg, Rechtsruck in Europa, Corona und der Ukrainekrieg waren noch weit entfernt. Uns fehlt nun Bowies einordnende Stimme. Sein letztes politisches Statement stammt von 2014: „Scotland, stay with us“. Es fiel in die Zeit einer Kampagne, die sich für die Unabhängigkeit Schottlands vom Vereinten Königreich stark machte. Das größere Übel, der Brexit, war nicht absehbar.
Bowie ist der erste ab den 1970ern groß gewordene Pop-Superstar, der in einem Alter von mehr als 60 Jahren (ihm fehlte nur ein Jahr bis zum 70. Geburtstag) eines natürlichen Todes starb. Und er hatte, anders als Prince und George Michael, Zeit, sich auf seinen Tod vorzubereiten. Jeder Mensch will für ein bestimmtes Bild in Erinnerung bleiben. Es muss nicht das letzte Bild, das letzte Foto sein, gerade dann nicht, wenn man todkrank ist. Aber David Bowie ließ sich krank fotografieren, todkrank, am 15. November 2015, etwas weniger als zwei Monate vor seinem Tod. Er sah gut aus. Aus der Ferne des Fotobetrachters: gut wie immer.
Er besuchte in New York City die Premiere des Musicals „Lazarus“, das sein Leben feierte, mit Musical-Versionen seiner Songs. Niemand schrieb über die Fotos, die einen lächelnden, sportlich schmalen Bowie mit sanft nach links gekämmtem, ergrautem Haar zeigen, wie er sich dem Publikumsapplaus hingibt, dass es sich hierbei um einen Menschen in seinen letzten Wochen handeln müsse.
Die letzten Bilder
„Lazarus“ war keine große News. Es war vielmehr so, dass kaum einer diesen Fotos vor seinem Tod große Beachtung geschenkt, sie im Netz aufgebauscht hätte – als Ankündigung seines Ablebens. „Lazarus“ erhielt mäßige Broadway-Kritiken, und nun stand eben jener Mann auf der Bühne, der diese Lieder komponiert, und der zwar seit seiner Rückkehr mit „The Next Day“ 2013 kein Interview gegeben und keinen Live-Auftritt mehr absolviert hat, aber nun wieder teilnahm am öffentlichen Leben. Bowie reiste auch. Er besuchte, wenn auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, seine „David Bowie Is …“ Wanderausstellungen in London und Berlin. Die Arbeit am „Spectator“-Musical, das auf „Lazarus“ folgen sollte, dokumentierte, dass er nicht an einen baldigen Tod geglaubt hatte.
Im handschriftlich verfassten Songtext von „Win“ schrieb Bowie Jahrzehnte vorher, 1975: „I say it’s HIP, to be ALIVE“ – „Hip“ und „Alive“ in Versalien. Er war kokainabhängig und fand, dass sein Überleben hip, ein Statement für die Popkultur sei. Eine pervertierte Form vom „Leben für die Kunst“. Er hörte auf zu essen und nahm umso mehr Drogen.
Von dieser Hipness hatte Bowie sich 40 Jahre später als Ehemann und zweifacher Vater längst verabschiedet. Und er hatte über einen Zeitraum von zehn Jahren, zwischen „Reality“ und „The Next Day“, bewiesen, dass er auch ohne Musik leben konnte. Aber irgendwann rief die Musik ihn wieder zu sich.
Warum seine Bedeutung wächst
Mike Garson glaubt, dass die Bedeutung David Bowies noch wachsen wird. Unsere Kindeskinder würden ihn noch kennen. „In 100 Jahren erinnern wir uns an folgende Musiker: Bob Dylan, die Beatles, John Lennon als Solomusiker, Prince, Stevie Wonder, Ray Charles – und Bowie.“ Unter all diesen Legenden sei Bowie die Nummer eins. „Er war nicht nur Singer-Songwriter und Performer. Er war Produzent. Ein Modezar. Ein großartiger Schauspieler. Er hätte in Hollywood sein und Oscars gewinnen können. Aber das gefiel ihm nicht. Er sang lieber – aber er war auch einmal Herausgeber eines Kunstmagazins. Bowie hatte Installationen in Italien. Er wird derjenige sein, an den man sich als den Michelangelo, den Rembrandt oder Da Vinci seiner Zeit erinnert.“ Seiner Einzigartigkeit bewusst habe Bowie seinem Management aufgetragen, bloß kein Biopic über ihn zu autorisieren.
Zum Ende des „Blackstar“-Epos singt Bowie: „Etwas geschah an dem Tag, als er starb / Der Geist erhob sich und machte Platz / Jemand anderes nahm seinen Platz ein und rief mutig aus: I’m a Blackstar, ich bin der Stern der Sterne!“.
Aber genau das ist es ja. Niemand traut sich zu, seinen Platz einzunehmen.
Und niemand könnte das.
Hat Bowie das denn wirklich nicht gewusst?