Die 50 besten Doppel-Alben aller Zeiten
Bei der Bitte an die Beiträger, empfehlenswerte, bedeutende, ja womöglich verkannte Doppelalben zu nennen, war der erste Gedanke: Wie oft werden „Blonde On Blonde“, das „Weiße Album“ und „The Wall“ genannt? Weil die Kollegen das aber auch bedachten, wurde Dylans Platte von 1966 zwar am häufigsten, doch nur fünfmal vorgeschlagen. Ausdrücklich wollen wir eine individuell gefärbte Übersicht von Alben dieses Formats, das ja jede auch ein Kunstformat ist, geben – und dabei auch entlegenere, nicht kanonisierte Alben berücksichtigen. Als Ausgangspunkt und Anlass: das 45. Jubiläum von „Physical Graffiti“ von Led Zeppelin, natürlich ein Flaggschiff des Verschwenderischen der früheren Vierseitigkeit auf Vinyl. Nach unserem Regularium gelten solche Veröffentlichungen als Doppelalbum, die auf Vinyl – oder später auf CD – als Doppelalbum konzipiert waren; wurde eine Doppel-LP später auf eine einzelne CD gebannt, bleibt es dennoch ein Double. Live-Alben sollten gelten, denn Konzertaufnahmen verlangen geradezu die üppige Form. Nicht zugelassen waren Tripel-, Quadrupel- und noch umfänglichere Platten, die ja eher dem entsprechen, was heute als „Boxset“ geläufig ist, und die auf größere Kohärenz (oder Inkohärenz!) aus sind. Das stärkste Vorkommen des Doppelalbums ist in den 70er-Jahren zu verzeichnen, als der Verkauf von Tonträgern olympisch wurde und die Rockmusik immer epischer, verzweigter, einfach größer, manche behaupten: megalomanischer. Hervorgebracht wurde das Doppelalbum aber in der zweiten Hälfte der 60er-Jahre, als die Ideen und der Anspruch in der populären Musik eine elaboriertere, auch wagemutigere und spielerische Bindung verlangten.
Ausgewählt und getextet von Wolfgang Doebeling, Jörg Feyer, Birgit Fuss, Max Gösche, Jan Jekal, Sassan Niasseri, Ralf Niemczyk, Gunther Reinhardt, Robert Rotifer, Frank Schäfer, Jörn Schlüter, Markus Schneider, Marc Vetter, Naomi Webster-Grundl, Arne Willander, Sebastian Zabel und Jürgen Ziemer.
Bob Dylan: „Blonde On Blonde“ (1966)

Als Bob Dylan am 5. Oktober 1965 im New Yorker Columbia-Studio mit den Aufnahmen zu „Blonde On Blonde“ beginnt, streiten sie noch heftig über seine Elektrifizierung und das Newport-Fiasko, beschimpfen ihn die Folkniks als Ketzer. Ein Jahr lang hat er Songideen gesammelt, während der nerven-aufreibenden Welttournee Zettel vollgekritzelt. Jetzt holt er sich die Hawks als Backingband ins Studio und zieht, nachdem es in New York nicht so gut läuft, nach Nashville um. Dort endlich entsteht das, was Dylan später „diesen dünnen, wilden Quecksilber-Sound“ nennt. „Blonde On Blonde“ erscheint dann am 20. Juni 1966, schließt nicht nur Dylans ersten Rockzyklus ab, der mit „Bringing It All Back Home“ und „Highway 61 Revisited“ begonnen hat, sondern darf auch als das erste Doppel-album in der Rockhistorie gelten. Frank Zappas „Freak Out!“ wird eine Woche später veröffentlicht.
Die 14 Songs verweigern sich verrätselt jeder Einengung. Dylan lädt Rock’n’Roll, Country, Folk und Blues surrealistisch, expressionistisch oder symbolistisch auf und gefällt sich in der Rolle des an Arthur Rimbaud und William Blake geschulten Erzählers, dem man niemals trauen darf. Während die dreiste, mit Blechbläsern dekorierte Satire „Rainy Day Women #12 & 35“ bekifft kichernd („Every-body must get stoned!“) nach New Orleans schielt, schlurft der Blues „Pledging My Time“ nach Chicago. Während das Großwerk „Visions Of Johanna“ ein verstörend-verworrenes Liebeslied ist, ist „I Want You“ eine als Popsong verkleidete Hymne auf das Begehren. Und am Ende erwartet einen das elfminütige Walzer-Versepos „Sad Eyed Lady Of The Lowlands“, das eine Plattenseite füllt, das ein Hochzeitslied für Dylans erste Frau, Sara, sein könnte und das Dylan damals für „den besten Song, den ich jemals geschrieben habe“, hielt. Gunther Reinhardt
The Jimi Hendrix Experience: „Electric Ladyland“ (1968)

„Electric Ladyland“ ist ein Paukenschlag wie „Blonde On Blonde“ und das „White Album“: eine Demonstration der künstlerischen Überlegenheit. Es war nie so sehr Hendrix’ viel gepriesenes Meistergitarristentum, sondern seine überwältigende Kreativität, die bis heute Rockmusikliebhaber-Kinnladen herunterklappen lässt. Auf diesem Doppelalbum genießt er die Freiheit wie einen LSD-Trip, gönnt sich viertelstündige Blues- und Psychedelic-Jams, streut immer wieder geniale Kompositionen ein („Crosstown Traffic“, „Voodoo Child [Slight Return]“) und schüttelt mit der Interpretation von Dylans „All Along The Watchtower“ eine der besten Coverversionen der Rockgeschichte aus dem Ärmel. MG
The Beatles: „The Beatles“ (1968)
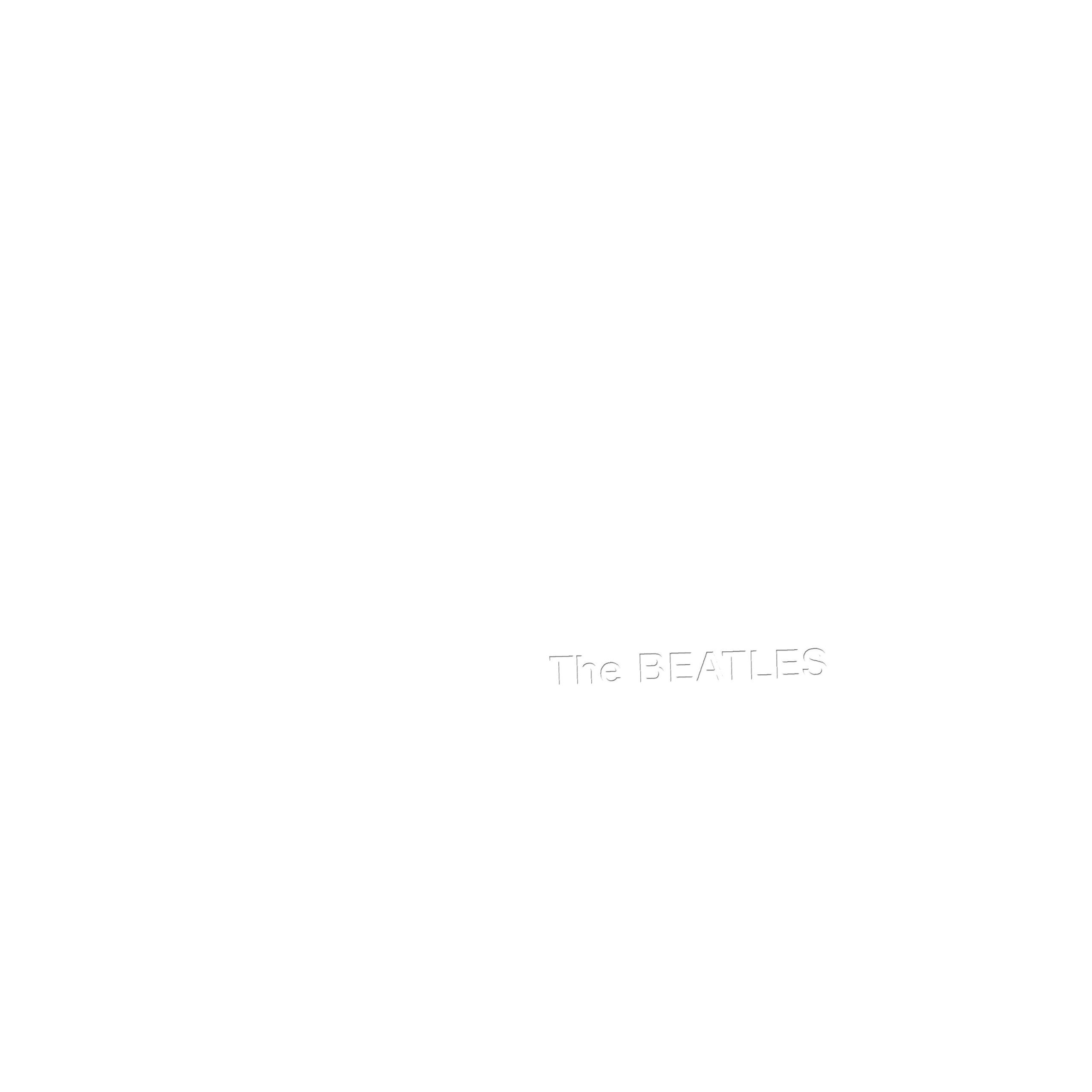
Das leere Cover ist eine Mogelpackung. Auf dem einzigen Doppelalbum der Beatles geht es in Wirklichkeit noch bunter und turbulenter zu als auf „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“. Den Riss, der längst schon durch die Band geht, kann man aber förmlich hören: Da Paul McCartneys Solo „Blackbird“, hier „While My Guitar Gently Weeps“ von George Harrison, der einfach Eric Clapton ins Studio holt, und dort John Lennons bizarre Collage „Happiness Is A Warm Gun“. Ein Album, das viele Ideen als Fragmente stehen lässt, ständig neue Genres ausprobiert, mit dieser inneren Unruhe und Zerrissenheit letztlich auch musikalisch das Jahr 1968 abbildet – und in der Postmoderne ankommt. GR
Bee Gees: „Odessa“ (1969)

Der in rotem Samtimitat mit Goldlettern gehaltene Umschlag sagte alles über den Größenwahn im Pop Ende der Sechziger. Damals von Rock-Hörern der Schnulzigkeit bezichtigt, berückt „Odessa“ aus fünf Jahrzehnten Distanz mit seinen komprimierten Klavierklängen, emphatisch schnarrenden Akustikgitarren, Bill Shepherds neoromantischen Orchesterarrangements und der Vokaldramatik der Brüder Gibb. Eine 1976 um Unverzichtbarkeiten wie „Black Diamond“, „Suddenly“ oder „Lamplight“ gekürzte, als einfache LP auf den Markt geworfene Neuausgabe dient als mahnender Gegenbeweis zur oft verbreiteten These, jede Doppel-LP lasse sich auf eine stärkere einzelne reduzieren. RR
Captain Beefheart: „Trout Mask Replica“ (1969)

Erstes offiziell modernes Kunstwerk der Popmusik. Beefheart grölt, grunzt, heult 28 Beatnik-Surrealismen in eine halluzinogene Welt, in der sich unter anderem steinalter Blues, ungestimmte Psycho-Gitarren, polyrhythmische Schepperdrums und seine trötenden Blasinstrumente aus vermutetem Free Jazz treffen. Quälix Van Vliet hat die Musiker angeblich monatelang im Laurel Canyon kaserniert und ausgehungert, um sein Konzept in die Hirne zu waschen. Zappa hat vier Stunden produziert. Für viele nachvollziehbar „Mission: Unlistenable“, aber wenn es kickt, will man nicht mehr runter und fühlt sich auf verwahrloste Weise befreit. Der „Dachau Blues“ ist ein rarer Kandidat für Adornos Jukebox. MS
Amon Düül II: „Yeti“ (1970)

Mit ihrer zweiten Platte ergriff die Kommunen-Band Amon Düül II der Wahnsinn. Mögen sich die Geister daran scheiden, ob das nun Prog-, Acid-, Psychedelic oder Krautrock ist: die Mischung aus kruden Studio-Improvisationen und bizarr vor sich hin treibenden Gitarren-Epen, die sich deutlich an King Crimson, Pink Floyd und den Space-Rock-Begründern Hawkwind anlehnen, schlug 1970 in Deutschland ein wie eine Atombombe. Alles läuft natürlich auf den sonderbaren Hippie-Folk von „Sandoz In The Rain“ hinaus, dabei hätte der mit allen eklektischen Mitteln gewaschene „Soap Shop Rock“, die ersten vier Tracks des Albums, als künstlerisches Statement grenzenloser Entrückung schon genügt. MV
Derek & The Dominos: „Layla And Other Assorted Love Songs“ (1970)

Das Über-Titelstück samt bekannter Bad-Love-Story hat zunehmend den Blick verstellt auf die 13 „Assorted Love Songs“, die dem Werk auch jenseits der Eric Clapton-Discografie eine Sonderstellung bescheren. Ebenso wie die Mitwirkung des freilich groß aufspielenden Duane Allman oft die Sicht verdeckt auf den heimlichen Star von „Layla And …“: In Bobby Whitlock (Delaney & Bonnie) hatte Clapton einen Co-Autor und eine zweite Stimme gefunden, die ihn selbst in später kaum noch erreichte Soul-Blues-Höhen trieb, in Songs wie „I Looked Away“, „Keep On Growing“ oder „Anyday“. Kein Jahr nach dem Release des Albums war Allman tot, und Clapton versank vorläufig im Heroin-Sumpf. JF
Miles Davis: „Bitches Brew“ (1970)

Nicht wenige riefen „Judas!“, als -Miles Davis einstöpselte. Eine mit elektrischem und akustischem Bass, drei Schlagzeugen und Percussions besetzte Rhythmusgruppe treibt an, drei E-Piani zeichnen Linien, kalt und souverän echot Miles Davis’ Trompete über der Improvisation seiner Band. „Miles schuf eine Art Umgebung“, sagte Bassist Dave Holland später. „Deine Aufgabe war es, herauszufinden, was du darin tust.“ Mati Klarweins sexy-surrealistisches Cover spiegelt den Zeitgeist ebenso, wie es das Format Doppelalbum und das Genre Jazz-Rock tun, das mit „Bitches Brew“ aufblühte. Es ist suggestive Musik, ein seltsam unfunky Funk, und es ist elektrische Musik, in jeder Hinsicht. SZ
Crosby, Stills, Nash & Young: „4 Way Street“ (1971)

Nach Feuertaufen in Woodstock und Altamont geriet die US-Tour 1970 für Crosby, Stills, Nash & Young zum Triumphzug. Ihre erste LP als Quartett, „Déjà Vu“, war gerade vielmillionenfach gekauft worden, das Publikum entsprechend enthusiasmiert. „4 Way Street“ wucherte mit Konzert-Highlights, die Songselektion war ausgewogen, die Egos der Alphatiere hinreichend gestreichelt, so schien es. Mit diesen Künstlern aufzutreten sei ein Privileg, war denn auch Neil Young voll des Lobs, „like being in The -Beatles“. Anders als bei Crazy Horse, das fühle sich an, als spiele man mit den Rolling Stones. „And the Stones have always been my favorite band.“ Da waren’s wieder drei. WD
The Rolling Stones: „Exile On Main St.“ (1972)

Gleich eingangs „Rocks Off“, ein Bündel nervöser Energie, tänzelnd im Zaum gehalten zuerst, dann freigelassen und wieder eingefangen, ungezähmt. Mittendrin ein Moment der Einkehr, das Tempo gedrosselt, die Töne spacey. „Feel so hypnotized“, maunzt Mick selbstverloren, „it’s all mesmerized, all that inside me“, bevor der Song die Sporen spürt und in gestrecktem Galopp in die Nacht geritten wird: „The sunshine bores the daylights out of me.“ Was für ein Opener! Oder „Rip This Joint“, eine rasende Rock’n’Roll-Furie von einem Track, mit Bobby Keys’ Sax im Overdrive. Slim Harpos „Hip Shake“ ist ebendas, der Groove unwiderstehlich, indes „Casino Boogie“ als Midtempo-Shuffle paradiert, Mick erinnerungsselig, „kissing cunt in Cannes“. Der brütende Funkhouse-Swing von „Tumbling Dice“ beschließt Seite 1 mit frivol lockender Coda. „You got to roll me …“
Im umfassenden Americana-Kontinuum von „Exile“ repräsentiert Seite 2 den akustischen, countryfizierten Teil. Gram Parsons’ Präsenz während der Aufnahmen ist spürbar, obwohl er bei den Aufnahme-Sessions in Keiths modrigem Keller in Südfrankreich nicht zugegen war. „Sweet Virginia“ geht mit Kalifornien ins Gericht, eine rostig schnarrende Honkytonk-Ode zu Sax und Harmonica: „Got to scrape that shit right off my shoes.“ Pedal-Steel-Licks unterfüttern „Torn And Frayed“, die autobiografische Ballade einer ramponierten Band auf Tour: „Let the guitar steal your heart away.“ Himmel, wie denn auch nicht?
Fiebrig waren die Sessions, das Album lief unter dem Arbeitstitel „Tropical Diseases“. Wolfgang Doebeling




