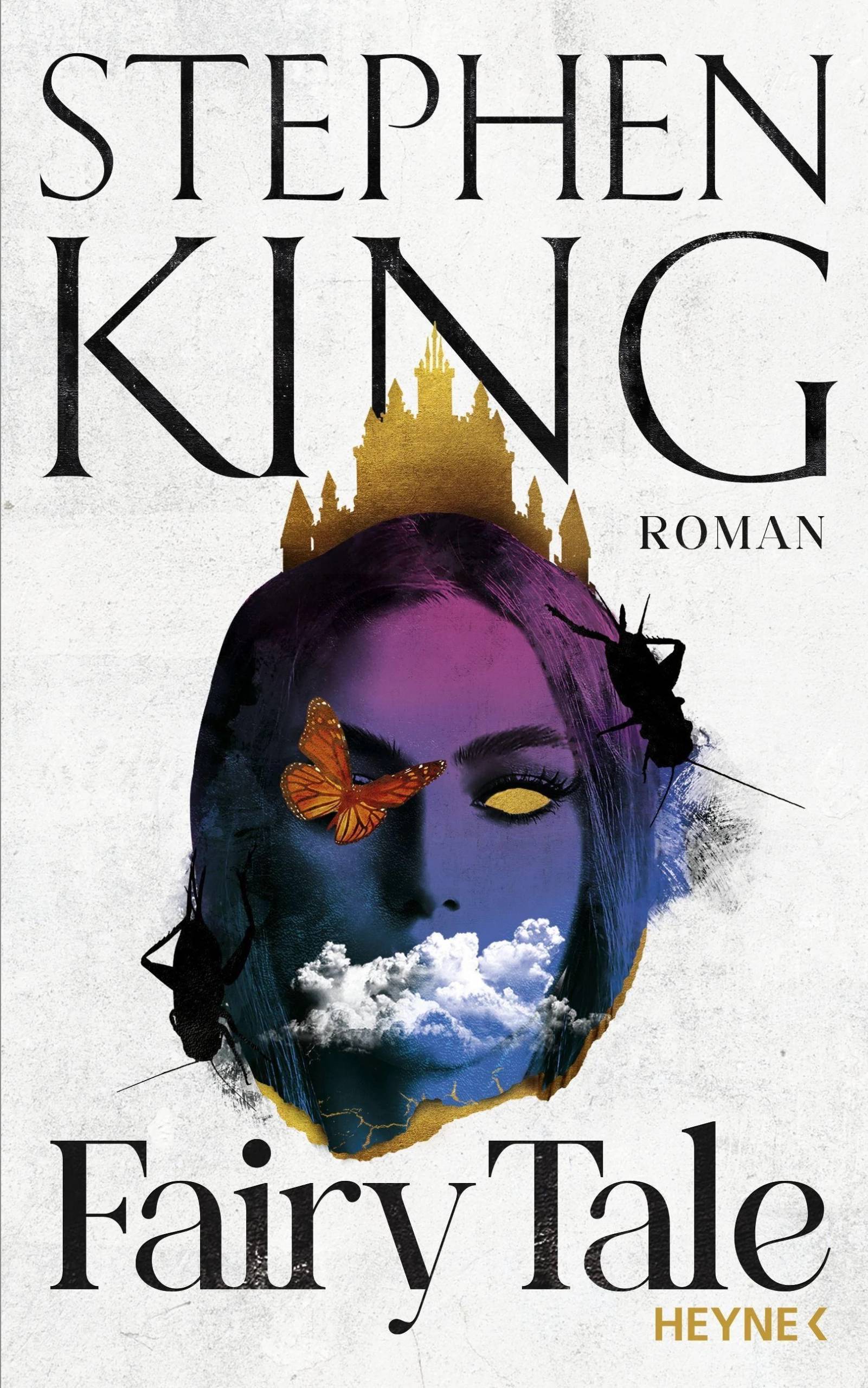Kritik: Stephen King – „Fairy Tale“ – warum so mutlos, Mr. King?
Man kann eine Erzählung durchaus nicht-deskriptiv betiteln: „Fairy Tale“ – „Märchen“. Deshalb allein muss sie nicht schlicht sein. Aber das Märchen muss dennoch mehr bieten als nur Genre-Betrachtungen auf der Metaebene – jedes Märchen braucht eine eigene Geschichte.
Stephen King ist 75 Jahre alt, er hat längst die Autorität und Größe, sich Geschichten auszudenken, in denen er über die berühmten Geschichten anderer berühmter Schriftsteller schreibt. Was früher „Namecheck“ hieß, heißt heute „Easter Egg“, oder, etwas weitergesponnen: „Sprung auf die Metaebene“. Schon in „Wolves of the Calla“ von 2003 ehrte er seine Kollegin J.K. Rowling, er verwendet Harry-Potter-Snitche als Wurfwaffen, und er ehrte George Lucas, er drückte seinen Leuten Lichtschwerter in die Hand.
Man sollte froh sein, dass wir nicht mehr in der Vergangenheit leben, zumindest nicht in den 1980er-Jahren, denn dann hätte sein deutscher Verlag den Titel seines neuen Romans „Fairy Tale“ vielleicht nicht im Original belassen, sondern ihn womöglich „Fantasie“ benannt, weil man damals Angst hatte, wir alle könnten kein Englisch. „Fairy Tale“ ist aber genau das, was die deutsche Übersetzung hergeben würde: ein Märchen. Ein Märchen ohne eigenen Namen, denn King vergnügt sich damit, derart viele Referenzen an Märchenklassiker einzubauen, dass nicht nur sein Protagonist, der 17-jährige Charlie Reade, am laufenden Band über vermeintliche Gemeinsamkeiten zwischen seiner und der fremden Welt schmunzelt, sondern dem Autor zeitweise die eigene Story abhanden zu kommen droht.
Da gibt es so einige Märchen, Filme, Serien oder Romane, denen King huldigt. Diese Liste der „Easter Eggs“ ist wahrhaft nicht vollständig: „Rotkäppchen“, „Game of Thrones“, „Masters of the Universe“, „Hänsel und Gretel“„Die drei kleinen Schweinchen“, „Arielle – die Meerjungfrau“, „Die Braut des Prinzen“, „Der Zauberer von Oz“, „Die unendliche Geschichte“, „Rapunzel“, „Rumpelstilzchen“, aber auch Modernes wie Joe Dantes Kinofilm „The Hole“ , in dem es um eine bösartige Macht geht, die über ein Loch im Schuppen in unsere Welt zu schwappen droht.
Das letzte Wort in Sachen Märchen?
Hat jemand dieses Buch von Stephen King verlangt? Ging es ihm darum, sich selbst in den Kanon der großen Märchenerzähler einzureihen? Das hätte er nicht nötig, er hat schon einige Märchen geschrieben, gute wie schlechte, sie sind nur nicht immer als solche zu erkennen – es sind Geschichten mit einer Heldenreise, mehr bedarf es dafür eigentlich nicht. „Doctor Sleep“, „It“, aber auch die offensichtlichen Ost-nach-West-Quests, wie „The Talisman“. „Fairy Tale“ ist das, was sein Titel andeutet: eine Leerstelle, die durch andere Geschichten gefüllt wird, an die der Horror-Großmeister in diesem Buch erinnert. Für King-Fanatiker ist „Fairy Tale“ womöglich eher so etwas wie das letzte Wort in Sachen Märchen. So groß, dass es keinen deskriptiven Namen mehr benötigt.
„Fairy Tale“ ist eine White-Saviour-Story: Ein Teenager vom Planeten Erde soll richten, was den Bewohnern der unentdeckten Welt namens Empis nicht gelang, eine Cthulhu-artige Kreatur besiegen, die das Land unterjocht und deren Bewohner mit einem Fluch belegt hat, der zu Missbildungen führt. Der junge Charlie steigt durch das Schuppenloch in dieses Universum, in dem allerhand Zombie-Ritter und überdimensionierte Tiere hausen.
Im Grunde ein schöner amerikanischer Kniff Kings, seinen Protagonisten für diese Heldenerzählung eigentlich nur deshalb nach Empis geschickt zu haben, damit er ein dort verstecktes Rad findet – denn Charlie hat seinen todkranken, altersschwachen Hund dabei, der auf dem Gerät gegen den Uhrzeigersinn, damit gegen die Zeit fahren soll und sich so pro Umdrehung um ein Jahr verjüngt. „Ich wollte nur meine Hund holen und zurück nach Hause“, sagt Charlie. Das hat in seiner rührenden Gefühligkeit schon was von den „Waltons“.
Hier zollt King, er schreibt es selbst, seinem Vorbild Ray Bradbury Tribut. Das verzauberte Karussell kennen wir aus „Das Böse kommt auf leisen Sohlen“, und einmal, wenigstens dieses eine Mal in diesem Roman, verzaubert auch King uns mit seinen Vorstellungen; am faszinierendsten sind Gedankenspiele, in denen wir uns der Frage hingeben, was eigentlich aus den legendären Maschinen berühmter Romane geworden ist. In Bradburys Buch brennt das Karussell ab, hier sinniert eine Romanfigur darüber, ob der Sci-Fi-König Bradbury nicht vielleicht selbst auf einem solchen Ringelspiel Platz genommen hatte – und es ausprobiert hat: „Was Bradbury … übrigens hat der sicher … ach vergiss es, aber präg ihn dir ein.“ Das macht neugierig. Von irgendwoher muss Ray doch seine vielen brillanten Ideen gehabt haben!
In solchen Momenten der Verschmelzung der Märchen mit ihren Autoren, der Frage, ob der Reichtum ausgedachter Erzählungen nicht auf tatsächlichen Erlebnissen beruht, wird auch „Fairy Tale“ zu einer starken Geschichte. In Bradburys Roman schafft es eine der zwei Hauptfiguren, der kleine Jim, fast nicht mehr vom Karussell runter, wird mit jeder Umrundung ein Jahr älter, bis er irgendwann ein Greis wäre, falls das Ding nicht gestoppt wird. Jim wird gerettet, aber King dichtet dem Jungen nun ein Weiterleben mit bösartiger Konsequenz an – er wird zeugungsunfähig und bipolar. Die Weitererzählung eines Klassikers, das ist etwas, das King kann.
Trump, das Klima
Aber Stephen King verfolgt seit den vergangenen 20 Jahren, angestachelt durch die Präsidentschaft George W. Bushs und massiv verstärkt durch Trump (der in fast allen seinen Büchern seit 2016 Erwähnung findet) eine politische Mission, die er in seine Texte hineinbemüht. Die Republikaner, aber auch die fernöstlichen Islamisten – King schafft es immer wieder, auf sie zurückzukommen. Die Autokraten von Empis werden mit dem „Islamischen Staat“ verglichen, und der Schluss des Romans liest sich wie eine Rede vor der UN. Empis ist gerettet, und dessen Retter Charlie beschließt, das Portal in diese nun wieder wunderschöne Welt auf ewig zu schließen, damit sie nicht von zufällig sie entdeckenden Erdenmenschen ausgebeutet werde: „Nach allem, was wir so vielen indigenen Völkern und dem Klima angetan haben, muss ich Dir da zustimmen“, sagt sein Vater, wie King ein trockener Alkoholiker. Das Klima, natürlich. Das Klima muss rein in das Buch.
Denn unsere Welt, das weiß Charlie, ist keinen Deut ehrbarer als Empis, nicht mal zu der Zeit, als dort „Flugtöter“ und „Nachsoldaten“ die misshandelten Menschen terrorisierten. Auf unserer Erde gibt es schließlich Atomwaffen, „und wenn das keine schwarze Magie ist, weiß ich auch nicht.“ Die Bewohner Empis‘ bewundern die Kleidung Charlies, die, wie er weiß, doch nur in einem Swaetshop in Vietnam genäht wurde – „hinter dem schönen Schein verbirgt sich …“ usw. Am Ende seiner Coming-of-Age-(nun ist der offensichtliche Begriff gefallen)Heldenreise hat Charlie nicht nur seinen Hund wieder fit gemacht, sondern auch seine Jungfräulichkeit verloren. „Fairy Tale“ ist somit auch eine Story über den nervigen Säfte-Stau Pubertierender. Woher sonst soll ein 17-Jähriger die Kraft haben, in „Squid Game“-ähnlichen Arenakampf-Situationen (wir mögen uns, wir Gefangene sind ein Team, aber wir müssen uns gegenseitig töten, bis nur noch einer übrig ist) einen Stiernacken fertig zu machen?
King wiederholt sich, und Wiederholungen sind etwas anderes als Selbstreferenzen, die doch so klug sein könnten. In der Schlusskonfrontation mit dem „Flugtöter“ vergibt King wie schon sehr oft die Chance auf einen wirkungsvollen Kampf, einen, der durch einen echten Plan entschieden wird. Aber wie schon im „Talisman“ oder bei „It“ wird das Monster allein durch Willenskraft, plötzlich vorhandene Energiehaushalte oder Beschwörungsformeln vertrieben, die diese Entität aus einer anderen Dimension nicht kennt. Das ist erzählerisch viel zu bequem. Die Grußformel-Erwähnungen aus seiner „Dunklen Turm“-Saga („es gibt noch andere Welten als diese“) sind im Gesamtwerk mittlerweile derart inflationär, dass sie nicht wie Verknüpfungen erscheinen, sondern wie Running Gags.
Immerhin gönnt King uns, anders als in „Black House“ oder „Der dunkle Turm“, das Erlebnis eines echten Happy Ends, keines mit doppeltem Boden. Am Ende ist es eben doch eine „Und wenn sie nicht gestorben sind …“-Geschichte. Und, immerhin, King kann noch Tausendseiter schreiben (in der deutschen Übersetzung).
Ein Blick auf die King-Werke der letzten zehn Jahre. Er hat seit 2012 die unglaubliche Zahl von 17 Büchern veröffentlicht. Die Taktzahl des älteren Herren ist natürlich phänomenal und nur unwesentlich entzerrter als zu Beginn seiner Karriere. Von diesen 17 Werken sind drei Romane herausragend („Mr. Mercedes“, „Revival“, „Billy Summers“) und zwei sehr gut („The Wind Through The Keyhole“, „Elevation“). Also sind etwas weniger als ein Drittel dieser Bücher geschaffen für den King-Kanon. Ist das eine gute Quote? Wahrscheinlich schon. Aber einige von Kings Einträge auf Twitter sind mittlerweile unterhaltsamer als die Romane.
(Heyne)