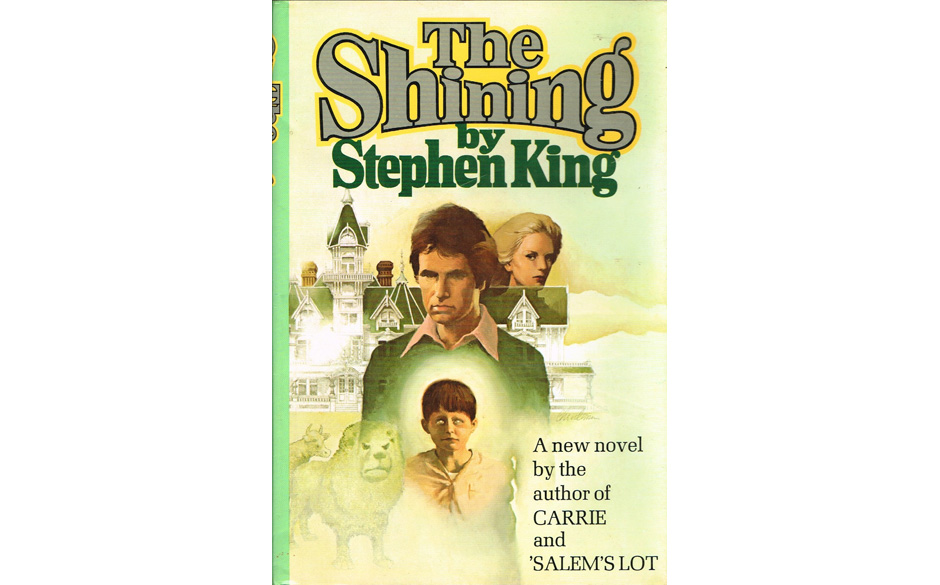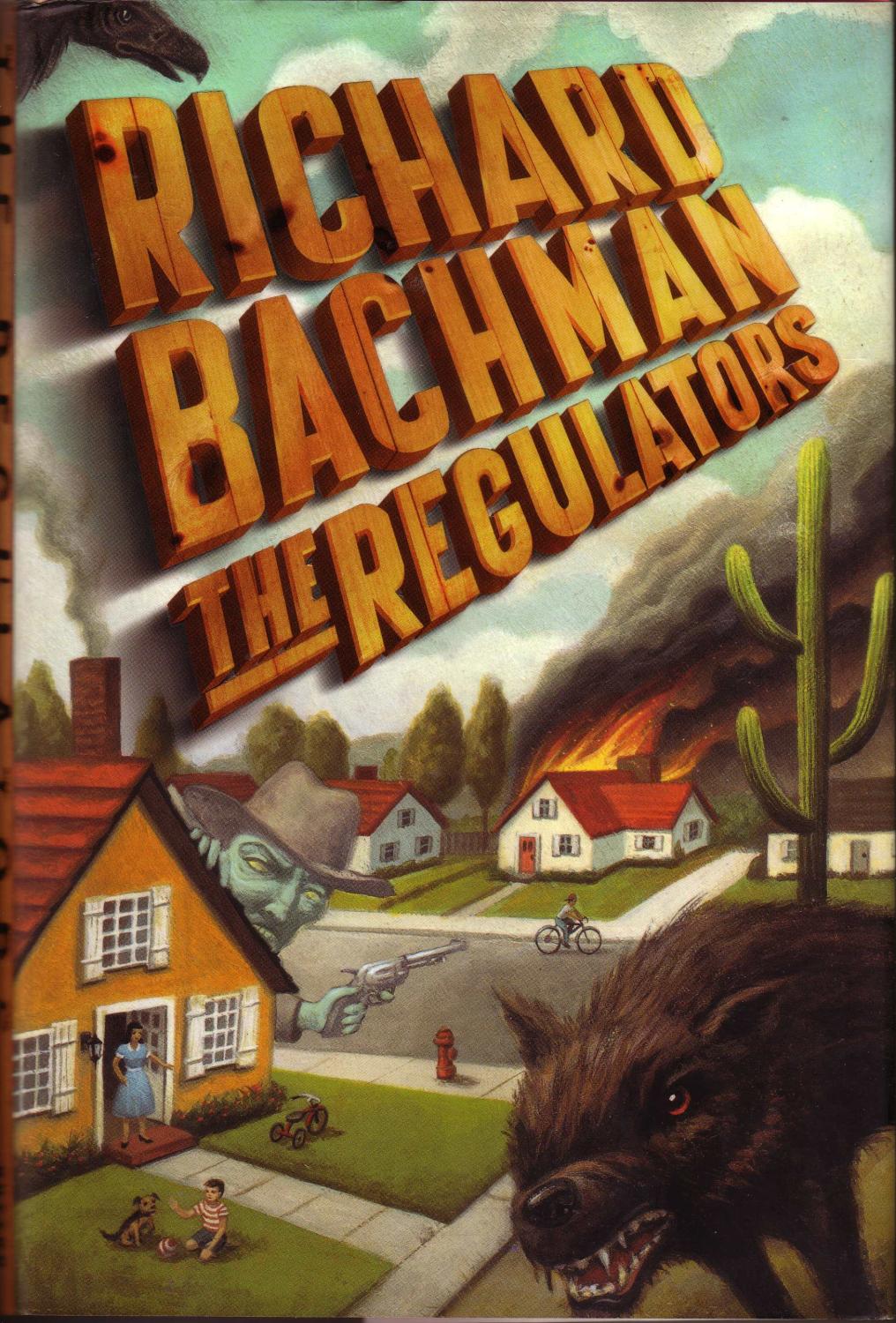Stephen King: Die besten Bücher – Plätze 30 bis 21
Stephen King: Alle Romane, Kurzgeschichten und Novellen-Sammlungen im Ranking. Sehen Sie hier die Plätze 30-21.
Stephen King – Das Ranking
30. The Shining (1977, deutsch: „Shining“) ★ ★ ★ ★
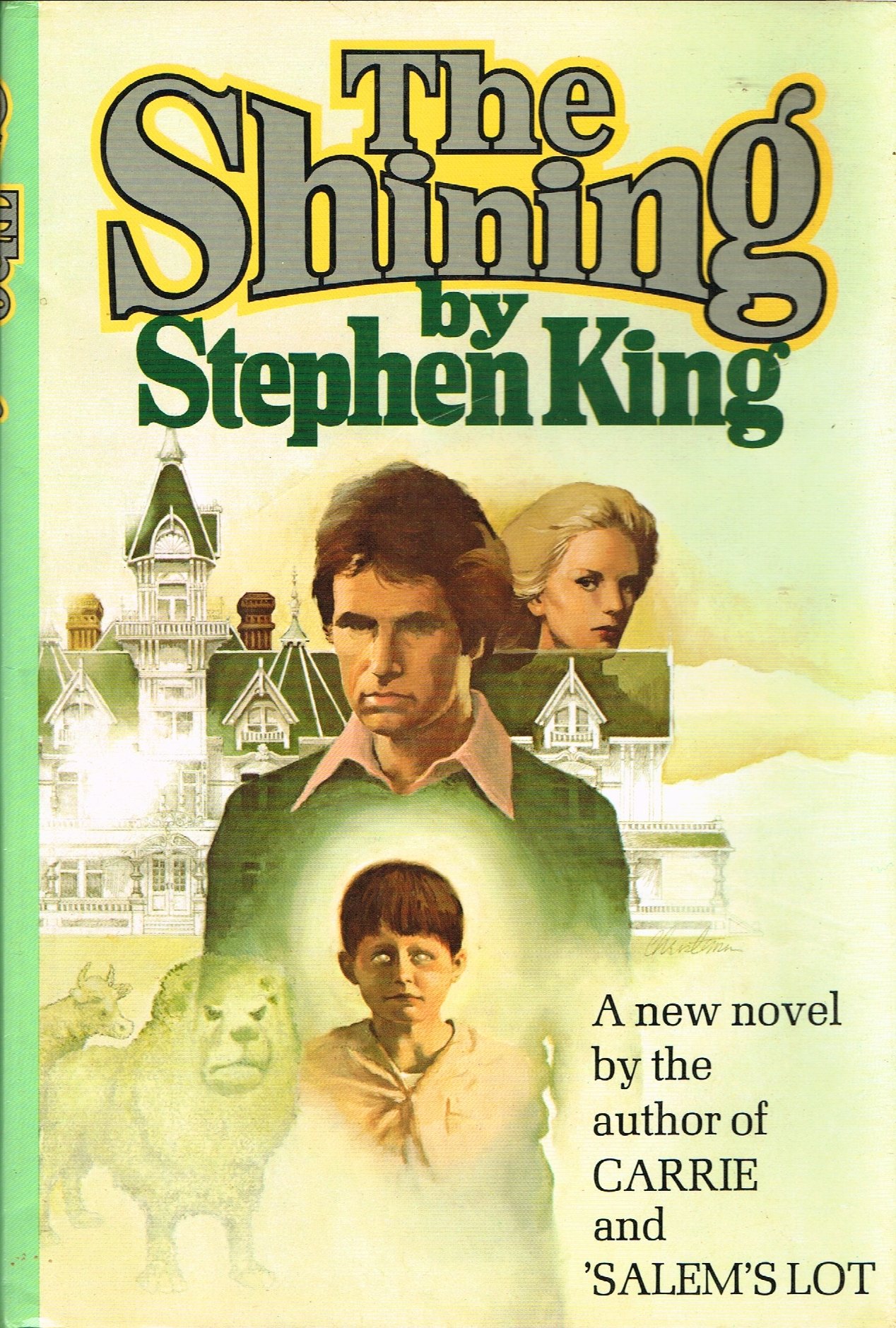
Stephen King: Die besten Bücher – Plätze 30 bis 21. Eine traumhafte Veröffentlichungsstrecke: Kings drittes Buch und der dritte Welterfolg. Und eine quasi-autobiografische Erzählung obendrein. Ein alkoholkranker Vater, wie King einer damals war, bricht seinem Sohn den Arm. Ein Hausmeisterjob im verlassenen, eingeschneiten Overlook-Hotel soll Ruhe bringen.
Stattdessen nehmen Geister von Jack Torrance Besitz, die ihn zum Mörder seiner Familie machen wollen. Sein größter Gegner wird der fünfjährige Sohn Danny, er verfügt über das „Shining“ – er kann Ereignisse voraussehen. Eine Gabe, der King in vielen folgenden Romanen Aufmerksamkeit widmet.
Stanley Kubrick würde später „Shining“ verfilmen – und King ihn danach für einige Zeit hassen. Der Regisseur strich das Thema Alkoholismus nahezu aus seinem Film. Beide, Autor wie Filmemacher, haben mit „Shining“ zwar sorgfältig komponierte Erzählungen geschaffen – wirkungsvoll aber sind sie nur bedingt. Zu den beeindruckendsten Roman-Szenen gehören noch die der lebendig gewordenen, bösen Heckentiere. Die Skulpturen aus Gras bewegen sich stets um einige Zentimeter auf einen zu, sobald man mal nicht hinsieht. Anschleichung im Unbemerkten. Nicht minder verstörend ist der wie von Geisterhand (tatsächlich von Geisterhand) betriebene Fahrstuhl, in dem Luftschlangen von einer geheimen Party zeugen.
Auf diesen Koch kann man bauen
Kubrick hatte all das leider nicht interessiert. Eine eigene Idee im Film wiederum ist dennoch besser als alles Schauerspiel, mit dem Stephen King aufwartete. Ein Versuch, ein Treffer: „Was Du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen“ – das ist der einzige Satz, den Jack Torrance (Jack Nicholson) in tagelanger, stiller, konzentrierter Arbeit auf seiner Schreibmaschine getippt hatte, tausendfach, auf einem riesigen Papierstapel. So geht Wahnsinn.
Umso lieber erinnert man sich an eine wichtige Nebenfigur, den Hotelkoch Hallorann, der zum Retter der Familie wird. Wenn Hallorann knapp zehn Jahre später, in „Es“ wieder Erwähnung findet, fühlt man sich fast in Sicherheit: Da wird es ihm gelingen, dem „Es“ ein kleines Schnippchen zu schlagen. Auf diesen Koch kann man immer bauen.
Der überzeugendste Kontrollverlust seiner Hauptfigur Torrance gelingt King übrigens nicht erst in dem Moment, als Jack mit Axt durch die einsamen Flure des Overlook-Hotels streift. Der Niedergang wird in den Gesprächen deutlich. Wie bei Alkoholikern so häufig, sind es die eng verbundenen Menschen, die einem helfen, aber alles abbekommen. In beispiellos selbstzerstörerischen Telefonaten verscherzt es sich der Hausmeister mit seinem Bewährungshelfer als auch seinem Arbeitgeber.
29. From a Buick 8 (2002, deutsch: „Der Buick“) ★ ★ ★ ★

Stephen King: Die besten Bücher – Plätze 30 bis 21. Die Unergründlichkeit des Todes und die Tatsache, dass Tote oder „tote Dinge“ keine Antworten auf Fragen bieten, das war eine der Inspirationen für diesen einzigartigen Roman.
Einzigartig, weil es hart für King gewesen sein muss, keine Antworten auf das „Warum“ zu bekommen, sich selbst zu verbieten, eine Auflösung zu liefern. Einzigartig, weil die Hüter des Buick 8 das unerklärliche Fahrzeug so hinnehmen, wie es ist. So lange es gut versteckt bleibt und sein Kofferraum nicht geöffnet wird.
Vorteil hat, wer den Sinn hinter dem Wagen gar nicht erst versucht zu erschließen. „Der Buick ist wie ein Puzzleteil, das nirgends reinpasst.“ Am besten, man lässt das Auto in Ruhe. Den Einsatzleuten der State Police, die den herrenlosen Buick abschleppen und im Schuppen unterbringen, gelingt das über viele Jahre auch recht gut. Ein Polizeischüler, der junge Ned, entlockt den Cops dann ihre Geheimnisse. Deshalb ist „Der Buick“ auch eine Story darüber, wie sich Wissen am besten behalten bzw. vermitteln lässt.
Die Venusfliegenfalle
Gelassenheit, fast schon Desinteresse bringen sie dem magischen Gefährt entgegen. Sie fühlen sich in ihrem Alltag gestört, die Maschine aus einer anderen Welt liefere ihnen einfach keine Pointe. „Das Ding, in dem du sitzt, mag ja lebendig sein, aber deshalb ist es noch längst nicht wert, dass du dich damit abgibst. Es unterschiedet sich nicht groß von einer Venusfliegenfalle oder Kannenpflanze. Du kannst an diesem Ding keine Rache nehmen. Es ist hirnlos.“ Die Polizisten stellen keine Fragen: „Wir hatten ein Weltwunder da hinten in unserem Schuppen, aber das änderte nichts daran, wie viele Schreibarbeiten wir zu erledigen hatten.“
Kann es solche Leute wirklich geben, Menschen, die ein außerweltliches Relikt finden, aber es nicht erforschen wollen? Schwer zu sagen, aber King stattet seine Polizisten mit Feingefühl, Anstand, Verschwiegenheit und Verantwortungsbewusstsein aus. Sie wollen um jeden Preis verhindern, dass das Auto wiederholt, wozu es fähig ist: Sein Tor zu öffnen in eine Welt, in der die Menschen nicht lebensfähig sind.
Diese Cops halten den Buick in Schach, und es ist ihr großes Glück, dass ihre Besonnenheit größer ist als ihre Neugierde. Eine Geschichte, die sich darum dreht, dass Leute sich unter Kontrolle halten müssen – ein ganz großes Vergnügen.
28. Full Dark, No Stars (2010, deutsch: „Zwischen Nacht und Dunkel“) ★ ★ ★ ★
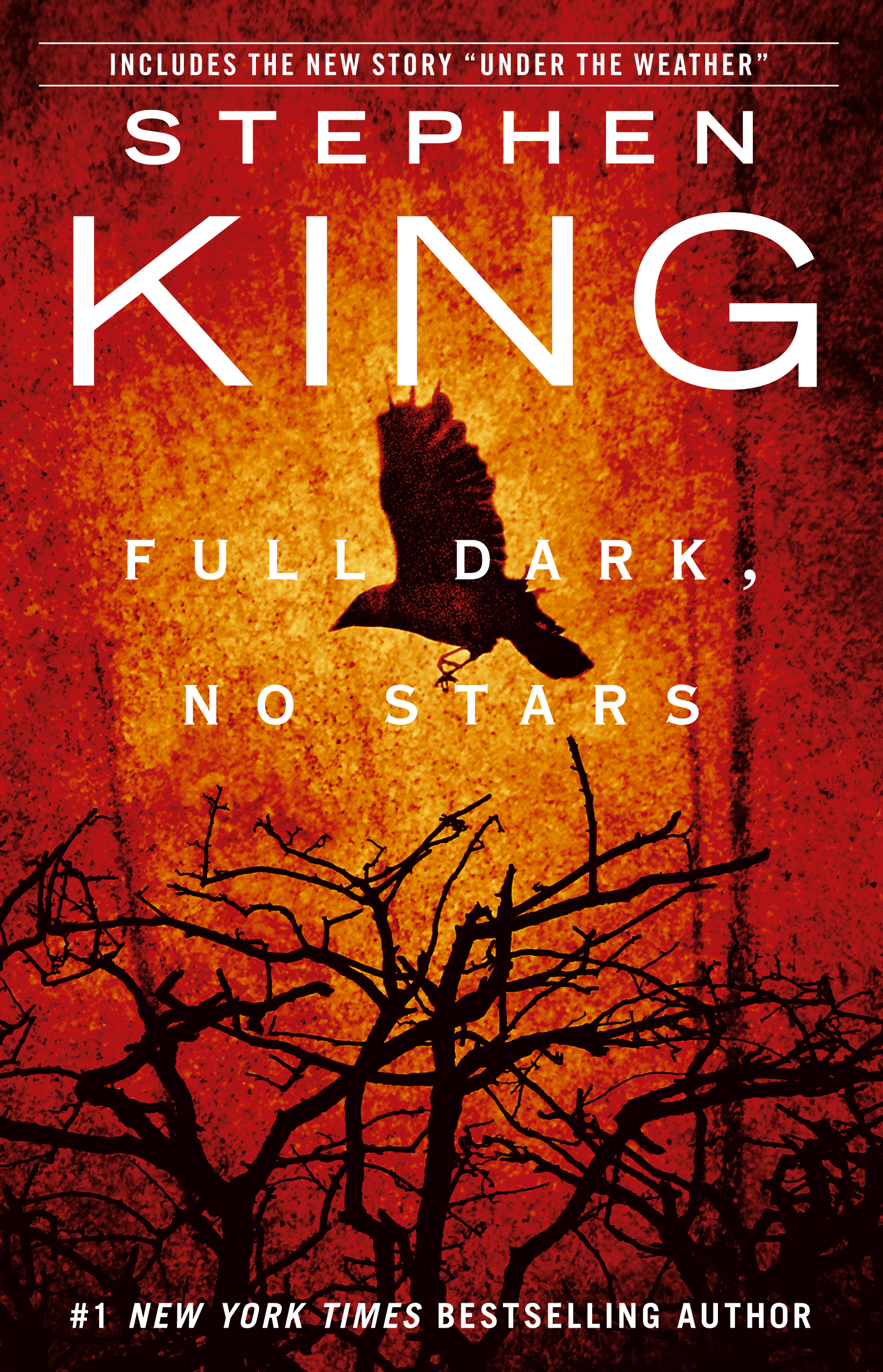
Stephen King: Die besten Bücher – Plätze 30 bis 21.Nach dem durchwachsenen Novellen-Band „Four Past Midnight“ zwanzig Jahre später ein echter return to form mit diesem Vierer. In allen Storys geht es um Rache und Sühne, und in einem Fall auch um die moralische Frage, ob man sich nicht doch auf die Seite eines Mannes schlagen kann, der sein Glück aus der Vernichtung eines anderen zieht („Fair Extension“).
„Fair Extension“ ist der Höhepunkt
„1922“, auch anständig für Netflix verfilmt worden, erzählt eine Geschichte über eine persönliche – und amerikaweite – Wirtschaftskrise, hier die eines Farmers, der eine Familientragödie herbeiführt, die ihm selber zu Grunde richten wird. „Big Driver“ ist eine extrem befriedigende Rape-Revenge-Story, behandelt natürlich auch die Kingsche Angst vor unberechenbaren Lesern. „Good Marriage“ ist, unter diesen sehr guten Geschichten, noch die am wenigsten sehr gute: die Geheimnisse der Ehe, der Horror, eine lange Beziehung völlig falsch eingeschätzt zu haben.
„Fair Extension“ ist der Höhepunkt: Ein Mann verkauft seine Seele an den Teufel, ohne Not. Er kann nur das schöne Leben seines langjährigen Freundes nicht mehr ertragen. King enthält sich jeglicher Bewertung dieses diabolischen Pakts, was den Betrüger Streeter fast unantastbar macht.
Der Mann muss an den Unbekannten Elvid (= Devil) lediglich Einkommen löhnen. An der Seele des Menschen ist er nicht interessiert. „Ich würde, wie man so sagt, seine Seele nicht erkennen, wenn sie mich in den Hintern bisse“, sagt der Beelzebub. „Nein, wie so häufig ist Geld die Antwort. 15 Prozent ihres Einkommens in den kommenden fünfzehn Jahren müssten reichen. als Vermittlungsgebühr, könnte man sagen.“ Der Teufel hat den amerikanischen Kapitalismus verstanden.
In seinem Nachwort schreibt King: „Die Storys in diesem Band sind hart. vielleicht ist es Ihnen teilweise schwergefallen, sie zu lesen.“
27. The Green Mile (1996) ★ ★ ★ ★

Der geistig behinderte, schwarze Riese John Coffey, der die Initialen mit Jesus Christus teilt, wird vom Regisseur Spike Lee gerne zitiert – als Beispiel für einen „super-duper magical negro“. Hinter dem „magical negro“ steht die Annahme, dass weiße Geschichtenerzähler eine schwarze Außenseiter-Figur mit besonderer Begabung konzipieren, deren Zweck für die Story ausschließlich darin besteht, die weißen Protagonisten in eine bestimmte Richtung zu lenken.
„Geschenk Gottes“
Auf „The Green Mile“ dürft das zutreffen. Der Fortsetzungsroman in sechs Bänden erzählt von einem Afro-Amerikaner, der im Jahr 1932 unschuldig zum Tode verurteilt wird, aber bis zu seinem unvermeidlichen Ende seinen Gefängniswärtern mit Zauberkräften bei deren Problemen unermüdlich hilft. Stephen King jedoch argumentierte glaubhaft, dass er nicht in die Falle des „magical negro“ tappen wollte. Es sei nur halt so, dass er schon immer eine Geschichte über „Old Sparky“ den Elektrischen Stuhl, schreiben und das in der amerikanischen Vergangenheit ansiedeln wollte. Er hat folgerichtig diejenige Figur als Todeskandidaten ausgewählt, die im US-Süden jener Ära oft die Höchststrafe erhielt: ein amerikanischer Schwarzer, der von vielen Weißen, weil ihm Schulbildung verwehrt blieb, als zurückgeblieben bezeichnet wurde.
King hat sich einfach nur in der Historie seines Landes umgesehen und den Stachel gesetzt.
Vor gewissen Schwankungen beim heiklen Thema Todesstrafe ist zwar auch er nicht geweiht, bisweilen schlägt er einen fast schon indifferent, pseudo-philosophischen Ton an („manchmal gibt es überhaupt keinen Unterschied zwischen Errettung und Verdammnis“, „wir sind zerbrechlich wie geblasenes Glas, sogar unter den besten Bedingungen. Um einander mit Gas und Elektrizität und kaltblütig zu töten?“).
King selbst hat sich im Laufe seines Lebens auch nie wirklich darauf festlegen wollen, ob er gegen sie ist oder dafür. Aber mit der Figur des Wärters Paul Edgecombe spielt er die Klaviatur widerstrebender Gefühle. Der hat mal das Gefühl, in die Hölle zu kommen, weil er „im Namen des Volkes“ das „Geschenk Gottes“ tötet. Während die Angehörigen der Ermordeten sagen, dass es Gottes Wille selbst ist, der den Stromschalter umlegt. Bei anderen Hingerichteten wiederum ist die Schuldfrage für die Wärter klar: „Er hat für seine Schuld bezahlt. Sein Konto ist ausgeglichen.“ Auge um Auge, Zahn um Zahn.
John Coffey, JC, Jesus Christus
John Coffey, JC, Jesus Christus, er ist der Mann, aus dessen Augen immer Tränen rannen, wie das Blut aus der nie heilenden Wunde. Für Edgecombe „trauerte er um die ganze Welt“. Für die Wärter wird der Inhaftierte zum Sohn Gottes, der selber, hier gingen bei King wohl ein bisschen die Pferde durch, zu den dramatischsten Tönen greift: „Jesuskindlein, bete für mich“, seine letzten Worte: „Ich bedaure, dass ich so bin.“ In seinen Memoiren „On Writing“ geht King auf den Vorwurf „symbolischer Banalität“ bei den Initialen JC ein. „Um was geht es hier, um Raketenwissenschaft. Also wirklich, Leute.“
„The Green Mile“ erschien zunächst in sechs Bänden als Fortsetzungsroman, dessen Weiterentwicklung er von Teil zu Teil konzipieren wollte. King begründete die eigentlich kluge Entscheidung mit dem Wunsch nach Gleichberechtigung zwischen Autor und Leser – beide seien damit auf dem gleichen Wissenstand. Und: „Sie können nicht vorausblättern und nachsehen, wie die Sache ausgeht.“ Unfreiwillig lustig jedoch ist die Ich-Erzählform, das Format Tagebuch: Wohl um Erinnerungen frisch zu halten, fasst Edgecombe von Ausgabe zu Ausgabe frühere Ereignisse zusammen. Unrealistisch, dass ein Tagebuchschreiber solche Dopplungen macht.
26. Skeleton Crew (1985, deutsch: „Blut“) ★ ★ ★ ★
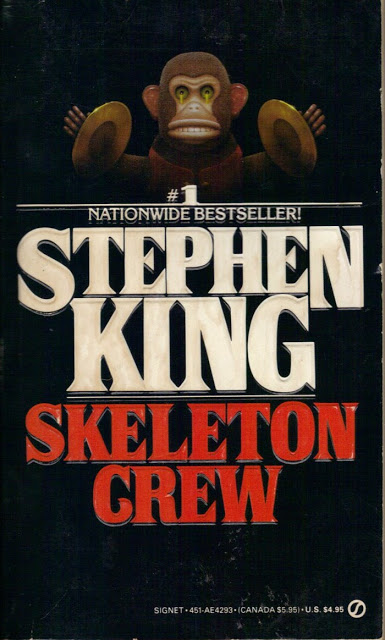
Kaum zu glauben, aber selbst in den 1980er Jahren veröffentlichte der Weltstar King einige seiner Geschichten noch in Magazinen wie „Playboy“ oder gar in Sci-Fi-Fanzines – was eigentlich ja für ihn spricht, er kennt seine Wurzeln. In diesem Sammelband, der auf Deutsch in mehrere Bücher zerlegt wurde, versammelt King Stories von ganz ganz früher („Here There Be Tygers“, 1968) bis 1984 („Gramma“). Die Veröffentlichung von „Skeleton Crew“ bot daher perfekten Anlass, den eigenen Story-Schrank auszuräumen, aber auch schwer Erhältliches an den Mann zu bringen.
Deutsche Verlage taten sich früher mit dicken King-Büchern immer besonders schwer (über unverschämte Kürzungen wird bei „The Tommyknockers“ und „It“ noch zu schreiben sein), und auch hier wurde das Gesamtwerk in der hiesigen Fassung zunächst in drei Einzelbände zerlegt: „Der Fornit“, „Der Gesang der Toten“, „Im Morgengrauen“. Einen guten Riecher bewies man zumindest mit der Idee, die grandiose Eröffnungs-Novelle „The Mist“ („Der Nebel“) als einzelnes Buch herauszubringen – ist dann nicht passiert, aber die „Bootleg“-Version erzielt im Netz hohe Preise.
„Der Nebel“ eröffnet den Reigen
Stephen King betont bei „The Mist“ häufig, dass die Story schon in den Siebzigern entstanden sei und zeitlich vor John Carpenters Horrorfilm „The Fog“. Hätte er nicht extra erwähnen müssen. Zwar kommen in beiden Werken bösartige Kreaturen aus dem Nebel, hier aus Nebel in reinstem Weiß, was es umso schauriger macht; jedoch sind diese Wesen hier von anderer Qualität als Carpenters Zombie-Seefahrer: Monster aus einer anderen Dimension, prähistorische Urviecher aller Größen, die mit ihrem Nebel den ganzen Globus einzuhüllen drohen.
Auf etwas mehr als 200 Seiten erzählt King hier eine seiner wirkungsvollsten Stories, mit Menschen, die sich vor dem großen Unbekannten in einem Supermarkt verschanzen (möglicherweise auch eine Hommage an den Freund George „Dawn Of The Dead“ Romero) und ahnen, dass sie in der neuen Weltordnung keine Chance haben.
Wie im Zombie-Genre müssen die Eingeschlossenen auch hier ihr Sozialgefüge neu verhandeln, im Lagerkoller sucht sich eine religiöse Fanatikerin ihre Jünger. Als der Protagonist David Drayton zu Beginn sein Haus verlässt, kündigt er beim Abschied von seiner Frau bereits an: „Bis heute habe ich sie nie wieder gesehen“ – frühe Spoiler an die Leser, wie in „Bag of Bones“ oder „Duma Key“, damit klar wird, dass sich die Geschichte vor allem um das Trauerverhalten der Hauptfiguren dreht.
Wie Philip K. Dick
Während grade die früheren Short Stories, wie „Here There Be Tygers“ oder „Cain Rose Up“, noch eine generelle, 1970er-typische Wut auf die Herrschaft der Elterngeneration reflektieren (so wie in „Rage“ von 1977 richtet sich die Aggression von Schülern vor allem gegen Erwachsene und konforme Mitschüler), zeigt King doch in anderen Geschichten einsame Klasse. „Mrs. Todd’s Shortcut“ über die Hinterländer Amerikas, und wie man am besten von A nach B kommt (mit der Hilfe einer anderen Dimension) ist genauso genial wie die Sci-Fi-Mär „The Jaunt“, das einer Fantasie von Philip K. Dick entsprungen zu sein scheint. Auf einer Reise zum Mars bekommt eine Familie Probleme mit dem Tiefschlaf.
Andere Hommagen sind nicht weniger geglückt: „Nona“ erzählt die Geschichte eines adoleszenten Mannes, der sich in eine Anhalterin verliebt, die ihn zum Morden anstiftet – die Erzählperspektive aus dem Irrenhaus heraus, der Twist am Ende sind ganz Richard Matheson; der Satanismus von „Gramma“ geht natürlich in der 1970er-Thematik des Satanismus auf, der vor allem rebellische Teenager zu befallen droht.
Vor allem Sex
„Survivor Type“ (1982), dem selbst King mittlerweile kritisch gegenüber steht, übertreibt es vielleicht ein wenig mit der Symbolik. Ein auf einer Insel Gestrandeter fängt im Drogenrausch an, seine Körperteile nach und nach zu essen, dokumentiert das mit schriller Typografie in seinem Tagebuch – King selbst verarbeitete seine Drogenabhängigkeit zunehmend literarisch.
Geradezu spektakulär ist „The Raft“, in dem sich Jugendliche auf einem Floß mit einem buchstäblich dunklen Fleck im Wasser auseinandersetzen müssen, der ihnen nach dem Leben trachtet, sobald sie auch nur einen Fuß in den See setzen. Die Kids beschließen daraufhin, all das auf ihrem kleinen Wassergefährt schnell zu machen, wozu ihnen wohl bald keine Zeit mehr bleibt: vor allem Sex.
25. The Dark Tower VII: The Dark Tower ★ ★ ★ ★ (2004, deutsch: „Der Turm“)

Stephen King schreibt es im Nachwort: Was er in den letzten drei Bänden des „Dunklen Turms“ betrieb, war Metafiktion. Und wie. Im finalen Band kommt „Stotter-Bill“ vor, der Held aus „It“, Carrie und ihr Zusammenbruch bei der ersten Periode, Cujo (was in der Sprache von Mejs „süß“ bedeuten soll), das Auto Christine, der Priester Callahan („Salem’s Lot“), Greg Stillson aus „The Dead Zone“ und natürlich, als einziges für den Plot wichtig: ein Ensemble aus „Insomina“. Als Erzählung eher durchschnittlich, wird ausgerechnet „Insomnia“ (deutsch: „Schlaflos“) von einer Figur gar als „fundamental“ neben dem „Turm“ bezeichnet.
Eine Parade wesentlicher Helden und Monster aus dem King-Kosmos also, versammelt für den monumentalen Abschluss des Lebenswerks des Autors.
Als würde er ein Schauspiel beobachten
Die natürlich auffälligste Meta-Ebene bezieht King als Romanfigur mit ein. Er ist der Autor, der die Erzählung vom „Dark Tower“ Jahrzehnte mit sich herumschleppte, mit der Entwicklung nicht vorankam, ängstlich und faul, wie er schreibt, und der seine Charaktere nahezu verkümmern ließ. Er muss hier als Deus Ex Machina in Erscheinung treten, mit einem leichten Kick von Roland kommt er in die Pötte.
Natürlich kokettiert King maßlos mit der vermeintlichen minderen Begabung, so wie schon im Vorgängerband „Susannah“. Es ist keine Kunst, mit dem Rückenwind einer der erfolgreichsten Schriftsteller aller Zeiten zu sein, das eigene Oeuvre kleinzureden. Über die Arbeit am „Turm“:„Natürlich steht keine Geschichte, außer einer schlechten, die von vornherein eine Totgeburt war, jemals völlig unter Kontrolle des Autors, aber diese hier ist so außer Kontrolle geraten, dass es schon lächerlich ist. Als würde er ein Schauspiel beobachten – oder ein Lied hören – anstatt eine verdammte erfundene Story zu schreiben.“
Mailer, Updike, King
Er verliert sich bisweilen in der Fantasie, seine Romane von Außenstehenden betrachten zu lassen. „King liest sich eben gut, das gestehe ich ihm zu – er kann gute Geschichten erzählen, hat aber erbärmlich wenig Sprachgefühl. Gott weiß, dass es Schriftsteller gibt, die sich einbilden, die ganze Welt hänge von dem ab, was sie fabrizieren. Norman Mailer fällt einem da ein, auch Shirley Hazzard und John Updike. aber in diesem Fall scheint die Welt wirklich davon abzuhängen. Rolands vernichtende Replik: „Er hört die richtigen Stimmen und singt die richtigen Lieder. Ka, sonst nichts.“
Die Verantwortung für das richtige Ende der Saga lastet schwer auf ihm, er bietet, wie auch im Roman „Black House“, zwei verschiedene Schlüsse an. Mit der eindringlichen Warnung, dass es ein Happyend sowieso nicht geben könne. „Sie lebten glücklich bis ans Ende aller Tage“ ist nicht mehr als ein schöner Traum.
Susannah verlässt Roland im Zorn, der kleine Bumbler Oy (eine Art Waschbär) opfert sich für den Anführer, sagt beim letzten Atemzug noch dessen Namen, der Junge Jake stirbt, Roland zerbricht fast am Gedanken, sich nicht von ihm verabschiedet zu haben. Nur Eddie Dean, den der Revolvermann vom Heroin wegbekommen hat, bekommt den Abgang, den er verdient hat, den des Revolvermanns – er stirbt, wenngleich er auch hinterrücks erschossen wird.
Ein großer Abschluss, das Rad dreht sich weiter
„Danke für meine zweite Chance. Danke … Vater“, sind seine letzten Worte an den Gründer des Ka-Tets. Vielleicht der in Wirklichkeit bedeutendste Satz im gesamten „Turm“-Opus aus acht Bänden. Weil er nicht wirklich etwas mit einer Suche zu tun hat, die keine Erlösung versprechen würde. Sondern einen echten Ertrag aus der Hilfe für einen anderen dokumentiert. Roland hat hiermit seinen Dienst in den Bänden eigentlich schon getan.
Rolands Einzug in den Dunklen Turm ist wahrlich spektakulär, er ruft die Namen all jener Gefährten, die er im Laufe seiner Reise opfern musste, darunter auch „Stephen King, jenem aus Maine.“ Sein Ende – und wer blättert nicht zum zweiten Finale vor – ist wahrlich hart. Aber leider das einzig konsequente. Ein großer Abschluss, das Rad dreht sich weiter.
Mordred gegen Flagg
Mehr als 1.000 Seiten (in der deutschen Übersetzung) ist die Geschichte lang, aber nicht alle Figuren wurden ausgeglichen gewürdigt. Sheemie stirbt abschiedslos weg, das Monster Mordred, ein Sohn und Rächer, so scheint es, wurde mit großem Brimborium ausschließlich geboren um Randall Flagg zu töten. An Roland kommt er nämlich nicht ran. Der kleine Bumbler Oy schaltet ihn fast im Alleingang aus.
Überhaupt, Flagg: Der bedeutendste Schurke in Kings Schaffen tapst in eine recht dämliche Falle, und er bekommt keine Gelegenheit mehr zum Kampf mit dem Revolverhelden.
Das Buch hätte daher vielleicht noch 200 Seiten länger sein dürfen
„Der Dunkle Turm“ ist damit zwar kein runder Roman geworden, King ist, Meta-Ebene oder nicht, zu selbstreferentiell, auch zu sehr bemüht politische Verbindungen zu ziehen (Nine Eleven berührt beide Welten).
Aber innerhalb einzelner Episoden – Eddies Tod, Callahans Opfer, die Cleverness des Ted, das wahre Gesicht Dandelos, Rolands Kampf gegen den Scharlachroten König, Rolands Beschwörungen vor dem Einlass in den Turm, sein Gang durch die Etagen, immer höher – ist seine Erzählung episch, spannend und einem Finale voller Wendungen angemessen. Das bisweilen hektisch erzählte Buch hätte daher vielleicht noch 200 Seiten länger sein dürfen, um den einzelnen Schicksalen mehr Raum zu geben.
24. Salem’s Lot (1975, deutsch: „Brennen muss Salem“) ★ ★ ★ ★

Kings Agent trug die Befürchtung vor, sein Klient könnte nach dem Sensationserfolg von „Carrie“ als „Horrorschriftsteller“ abgestempelt werden, sollte er mit diesem Buch wieder ein Genrewerk veröffentlichen wollen. Dessen Reaktion: „Horrorschriftsteller? Sehr gut!“.
Diese amerikanische Perspektive war neu
Damit stand die Entscheidung für „’Salem’s Lot“ fest. King suchte sich ein scheinbar sicheres Horror-Terrain aus. Die Welt der Vampire. Vor allem aber baut er eines seiner wichtigsten Themen weiter aus. Die Entfremdung von den eigenen Kindern, die hier, als Blutsauger, zur Heimsuchung werden. Mit Kleinstädten fühlte der Autor sich stets wohler als mit den Großstädten. Die Chronik des 2500-Seelen-Nests ‚Salem’s Lot, und wie deren Bewohner nach und nach dem Schrecken aus dem Marsten-Haus verfallen, steckt voller liebevoller Details. Die Naturbeschreibungen, die Gezeiten und Stürme enthalten einen Zauber, mit dem der damals 28-Jährige King einem seiner Vorbilder, Ray Bradbury, sehr nahe kommt.
Schaurig ist die Vorstellung, dass die tranigen Einwohner vor den Vampiren nicht die Flucht ergreifen, sondern lediglich kapitulieren. Sie ziehen die Vorgänge zu und warten auf das Unausweichliche, bis die Stadt immer ausgestorbener wird. Sie sind die Menschen, die sich vor politischer Korruption, vor Watergate und Nixon, weggeduckt haben. Als Vampire wirken sie nicht wie die noblen Blutsauger aus dem Stoker-Kosmos, die bemantelt und mit guten Manieren durch Europa streifen. Sondern wie kranke Hobos aus dem Mittleren Westen. Diese amerikanische Perspektive war neu.
Das Trauma verarbeiten
Selbst die Arschlöcher, Saufköpfe und Taugenichtse aber erhalten vom Autor eine gewisse Daseinsberechtigung. Ihre groteske Lebensführung treibt sie schnell in die Arme der Untoten. Wenngleich „’Salem’s Lot“ mit seinen schematischen, fast schon archetypischen Rollenzuschreibungen, der Priester, der Tankwart, der Bestatter, auch als Seifenoper funktionieren könnte.
Vor allem mit den beiden Hauptfiguren Ben Mears und Mark Petrie schuf King zwei seiner interessantesten Charaktere. Der Junge Mark will die vom Vampir Barlow ermordeten Eltern retten. Er selbst ist eine durch und durch kompetente, vor seiner Zeit gealterte Seele. Noch trauriger anzusehen ist Ben Mears. Der Schriftsteller – den einige Leute, hier hat King selbst anscheinend ein Elefantengedächtnis gezeigt, für einen Taugenichts halten – kehrt nach ‚Salem’s Lot zurück um Kindheitserinnerungen zu verarbeiten. Der Mann kann einem Leid tun, da er nur mit Frieden mit der Vergangenheit schließen möchte. Seine Depression aufgrund der schrecklichen Ereignisse aber natürlich nur noch wächst.
„’Salem’s Lot“ ist einer von Kings furchterregendsten Romanen
Die Nüchternheit, mit der Stephen King das Schicksal von Mears‘ junger Liebe Susan Rogers beschreibt – so eben hatte das Schicksal sie getrennt, in der nächsten Nacht fliegt sie als Vampir vor sein Fenster – zählt zu seinen größten erzählerischen Momenten. Überhaupt ein frühes Zeichen seiner Klasse: „’Salem’s Lot“ ist einer von Kings furchterregendsten Romanen, voller neuer Ideen. Und das im von etlichen Autoren vermeintlich vollständig durchleuchteten Sujet, dem Vampir-Roman.
Die Geschichte beschäftigte King auch lange Zeit danach. Der Priester Callahan, in diesem Roman von Barlow gebissen und seitdem als eine Art fieberhafter Hobo per Bus unterwegs, würde in den „Dark Tower“-Romanen wieder auftauchen. In zwei später publizierten Kurzgeschichten beleuchtet der Autor außerdem die Entstehung des Bösen in ‚Salem’s Lot.
„Fast alle Leute hielten den Mann und den Jungen für Vater und Sohn“ lautet der erste Satz, und er ist bis heute Kings bester geblieben.
23. On Writing – A Memoir of the Craft (2000, deutsch: „Das Leben und das Schreiben“) ★ ★ ★ ★
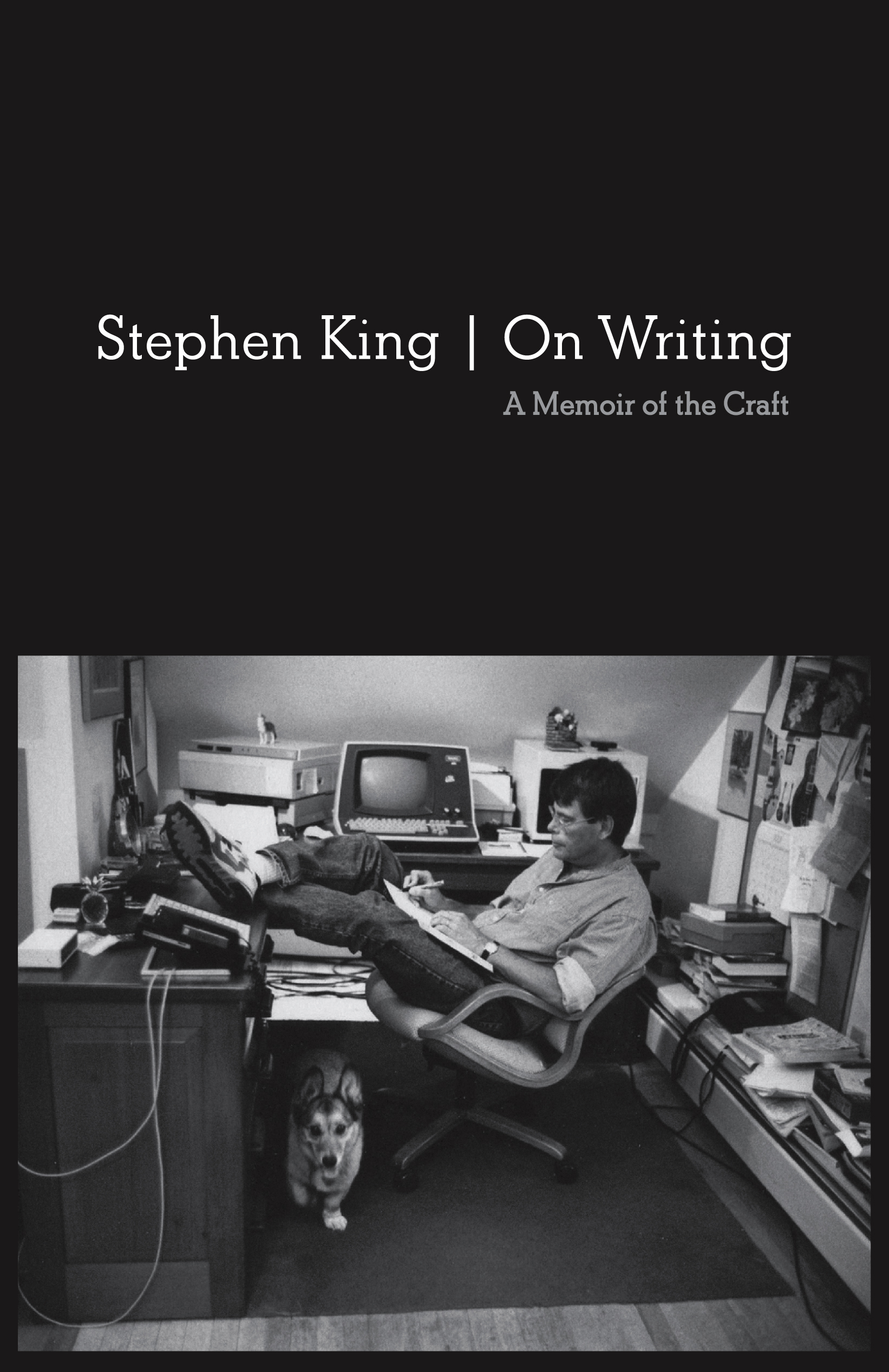
Je kürzer das Werk, desto weniger Blödsinn steht drin, das war Stephen Kings Motto. Mit knapp 400 Seiten (deutsche Übersetzung) wurde es dann eher mitteldick. Aber die Autobiografie ist nicht eine einzige Seite zu lang – und erschien kurz nach dem Autounfall, der dem Fußgänger King, bei Buchveröffentlichung 53 Jahre alt, fast das Leben gekostet hätte. Der Zeitpunkt hätte also nicht besser kommen können.
Die Erinnerungen gliedern sich grob in zwei Abschnitte, eben „Schreiben“ und „Leben“. Aus der deutschen Übersetzung in den längeren, biografischen Titel lässt sich schließen, dass man Absatzverluste befürchtete, könnten Leser denken, King äußere sich nur zu seinen Arbeitsmethoden. Wer andererseits glaubt, der Meister führe unzählige frühkindliche, traumatische Ereignisse für seine überbordende Fantasie an, wird milde enttäuscht.
Der Bohrer und das Efeu
Das Meiste ist eher tragikomisch. Die 100-Kilogramm-Babysitterin, die sich auf sein Gesicht setzt und furzt; der kleine Stephen fühlt sich sogar wohl im Versteck, dem kleinen dunklen Wandschrank; er spielt auf einem verwilderten Grundstück, das zur Inspiration für die Barrens in „It“ wird; er wischt sich den Hintern ausgerechnet mit Efeu ab und erleidet tagelang Schmerzen; ein Arzt bohrt dreimal in seinem Ohr herum, der Klang hallt noch heute durch sein Gehirn.
King war jahrelang hochgradig drogenabhängig, Alkohol und Kokain, einige Bekenntnisse waren bekannt: Er schrieb „The Tommyknockers“ mit Puls 130 und Tampon in der Nase, um die durch das Koks ausgelösten Blutungen aufzuhalten. Anderes ist neu und macht einfach nur traurig. Bei der Grabrede für seinen Vater war er betrunken.
Nach seinem Unfall kam das Schmerzmittel Percocet hinzu, was seine Schreibproduktivität hemmte. Er erinnerte sich an die ersten Rettungsmaßnahmen und Gedanken, die von berührender Klarheit waren: „Ich will nicht sterben. Ich liebe meine Frau, meine Kinder, meine nachmittäglichen Spaziergänge am See.“ Eine bizarre Synchronizität: Der Unfallverursacher, Transporter-Fahrer Bryan Smith, starb ein Jahr später, vermutlich an einer Tabletten-Überdosis – an Kings Geburtstag. Er erzählt das alles nüchtern, und, bei King nicht selbstverständlich, sogar mit – gutem –Humor.
„Schreibe bei geschlossener Tür, überarbeite bei offener Tür“
„Schreiben ist veredeltes Denken“: Wer selber schreiben lernen oder sich einfach verbessern will, wird im zweiten Teil der Memoiren perfekt abgeholt. King erteilt manchmal eher abstrakte Ratschläge (erst die Geschichte konstruieren, dann die Thematik, nie andersrum), gibt jedoch auch richtig gute einfache Tipps: weniger Fernsehen gucken, weniger Adverbien verwenden, auf „sagen“ als Verb setzen. Er bietet auch eine sehr lange Erklärung über die Wichtigkeit von Text-Absätzen („Absätze sind Landkarten mir Absichtserklärungen“) und der Notwendigkeit, uneitel zu sein und seinen Text zum Redigieren zur Verfügung zu stellen: „Schreibe bei geschlossener Tür, überarbeite bei offener Tür.“
Rührend sind die Versuche, die Kunst des Schreibens überhaupt zu beschreiben. Zu seinen Königen zählen Shakespeare, Yeats und Faulkner. „Genies, göttliche Zufälle mit einer Begabung, die wir nicht begreifen können, erlangen schon gar nicht.“ Aber er stellt die Kunst nicht über das Leben an sich: „Das Leben ist kein Stützgerüst für die Kunst. Es ist andersherum.“
Eine Offerte Kings sollten Sie jedoch, auch fast 20 Jahre nach Erscheinen des Buchs, nicht annehmen: Ihm per Mail an seine Homepage Schreibversuche zu schicken, die er eventuell durchlesen und noch eventueller dann beantworten würde. Es müssen damals sehr viele Mails bei ihm gelandet sein – auf seiner Seite gibt es inzwischen einen klaren Hinweis, dass er diesem Angebot nicht mehr nachkommen könne.
22. Dolores Claiborne (1992, deutsch: „Dolores“) ★ ★ ★ ★
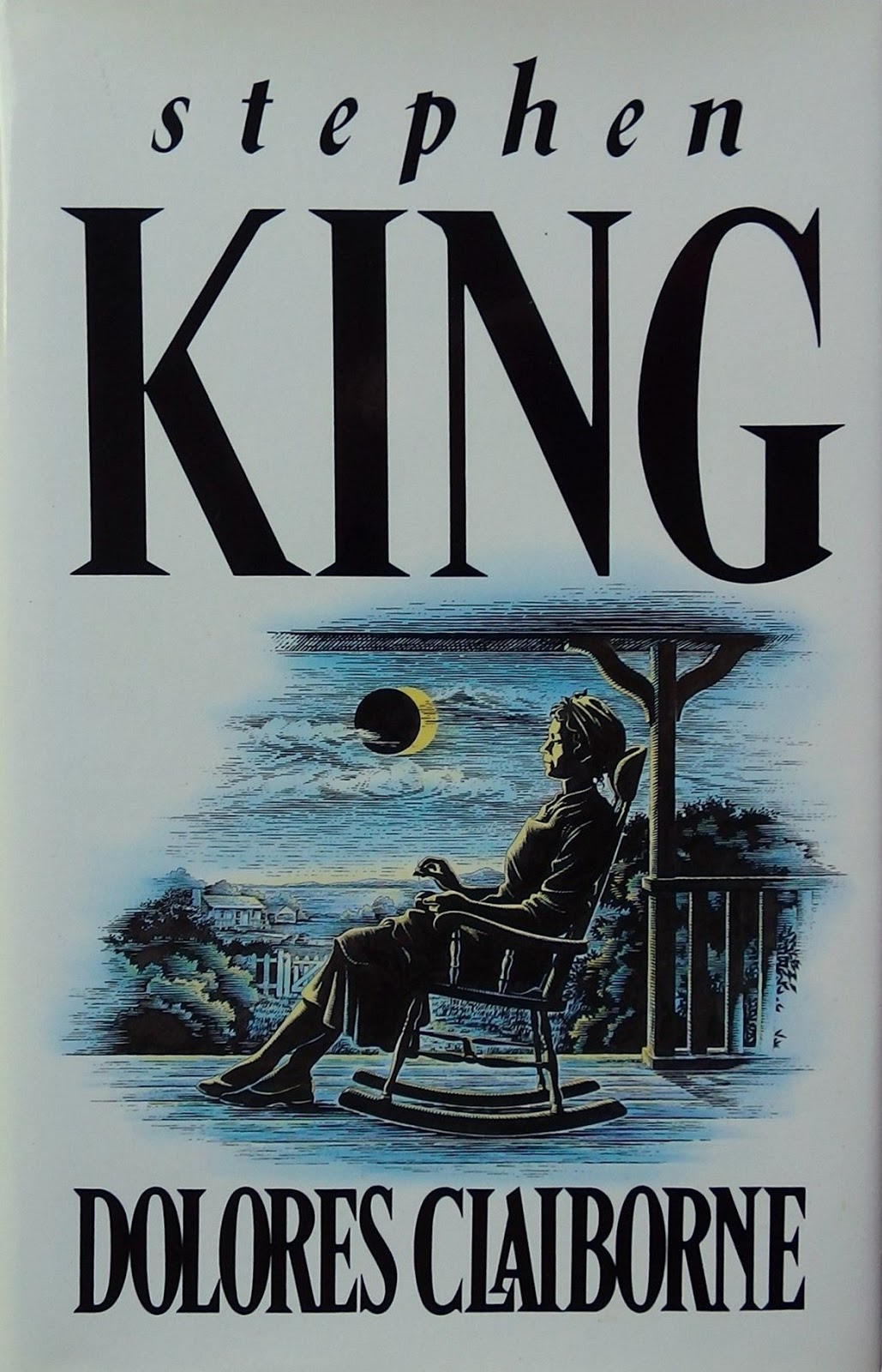
Nach „Rage“ und „Misery“ der dritte Roman Stephen Kings, in dem Übersinnliches keine Rolle spielt – abgesehen von einer Vision Dolores Claibornes, in der sie während einer Sonnenfinsternis „das kleine Mädchen auf dem Schoß ihres Vaters“ sieht, ihre Leidensgenossin Jessie Mahout aus „Gerald’s Game“.
Im Jahr 1992 widmete King sich erstmals seit fast 20 Jahren, seit „Carrie“, mit Jessie und Dolores in zwei verschiedenen Büchern alleinigen weiblichen Protagonistinnen. Der neue Kurs kam bei Lesern gut an, beide Romane dominierten, der eine im August, der andere im Dezember, die Bestseller-Liste der „New York Times“; und das in deinem Jahr mit neuen Büchern von Michael Crichton, John Grisham sowie dem „Vom Winde verweht“-Nachfolger von Alexandra Ripley, „Scarlett“.
Das Buch trägt Dolores Mädchennamen, Claiborne. Selbst in der Ehe mit dem gewalttätigen Joe St. George bleibt sie eine Claiborne, keine St. George. Der Mann hat sie missbraucht, sie kehrt, zuerst innerlich, dann schafft sie Tatsachen, in ihr Leben ohne den Aggressor zurück.
Wer anderen eine Grube gräbt
Auf der Polizeiwache erzählt Dolores – im Buch als Monolog ohne Kapitel-Unterteilungen, selten bei King – von ihrem Leben. Die mittlerweile 65-Jährige Haushälterin wird verhört, weil sie verdächtigt wird ihre Arbeitgeberin getötet zu haben, die reiche Vera Donovan. Deren Tod hat sie nicht verschuldet. Wohl aber den ihres Mannes Joe. Sie nutzt das Verhör zur Beichte.
„Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein“, vor dieser Konsequenz wird sie bewahrt. Dolores‘ Plan geht auf, der Trunkenbold fällt durch den Bretterbeschlag in den Brunnenschacht, versucht sich zwar hochzukämpfen, aber der Schädelbruch durch den Sturz macht ihm den Garaus.
Stereotype Beschreibung des anderen Geschlechts
„Dieser Mistkerl gab einfach nie auf“, gibt Dolores vor der Polizei zu Protokoll. „Wenn er so gelebt hätte, wie er gestorben ist, dann hätte es zwischen uns beiden vermutlich nie Probleme gegeben“. Damit bringt sie die Jämmerlichkeit solcher Eheleute auf den Punkt, die schon früh jeden Respekt vor ihrer Partnerin ablegen.
Die häusliche Gewalt in den 1960er-Jahren ist natürlich zentrales Thema, aber auch für Stephen King als Erzähler ist der Roman ein Erfolg. Ihm gelang in „Dolores Claiborne“ wie in „Gerald’s Game“ eine wenig stereotype Beschreibung des anderen Geschlechts. Zwar müssen beide, Dolores wie Jessie, sich von ihrem Männern emanzipieren, die Abarbeitung ist Kings ewiges Thema. Aber die Emanzipation ist nicht Teil eines notwendigen Entwicklungsschritts, um als Frau zu wachsen – beide Charaktere sind bereits stark, sie müssen sich nur noch schlicht von lästigen Menschen (und Erinnerungen!) befreien.
21. The Dark Tower V: Wolves of the Calla (2003, deutsch: „Wolfsmond“) ★★★★
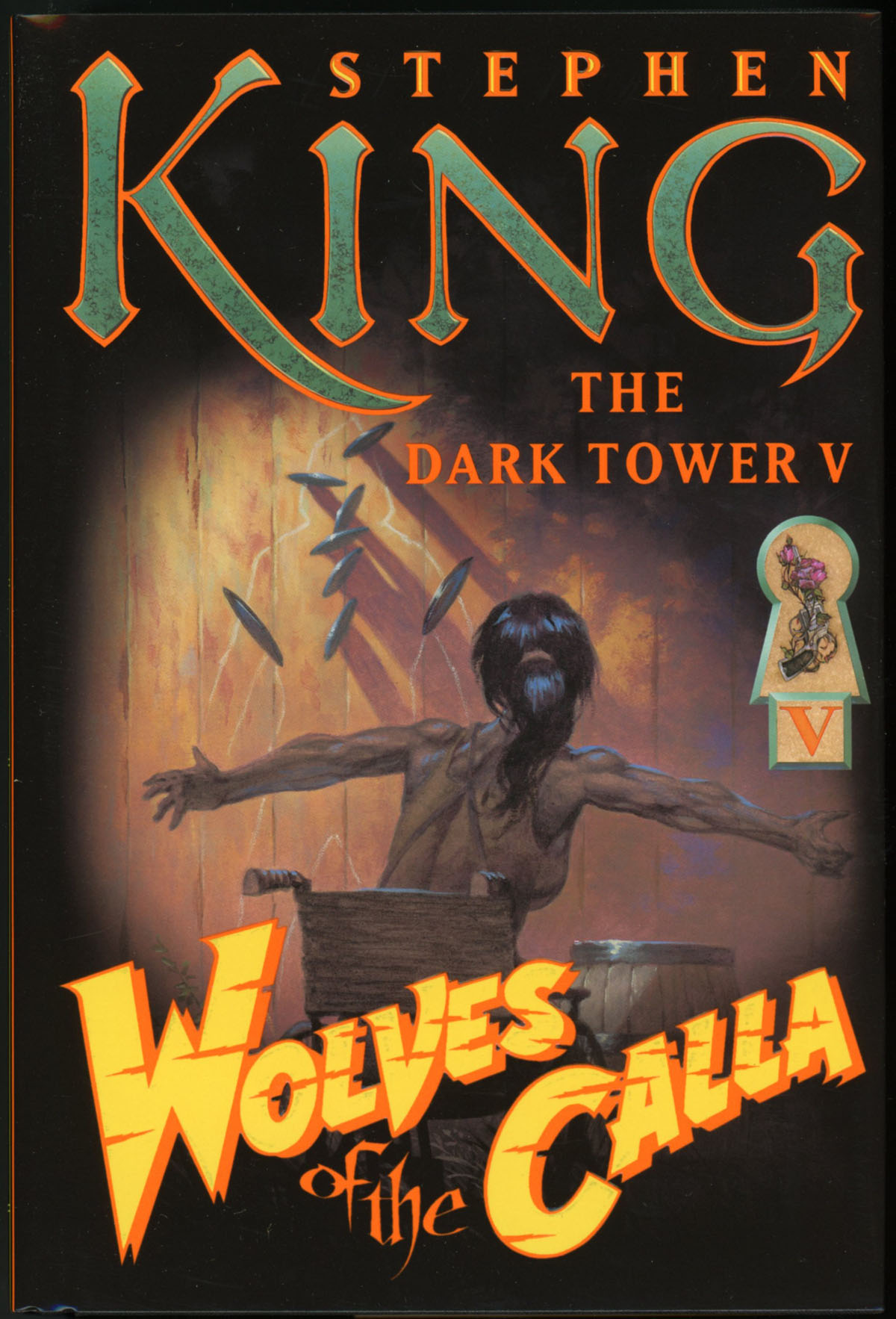
Stephen Kings wilder Cowboyritt durch die Popkultur. Alles Meta, Meta, Meta. Er liebt ja Harry Potter, also haben die Kämpfer hier Zauberbesenstiele, und die Wurfkugel, Schnaatze genannt, weisen sogar ein eingedrucktes „Harry Potter“-Siegel vor. „Star Wars“-Laserschwerter gibt es auch, außerdem Roboter aus den Marvel-Comics, „Dr. Doom“.
Der Gipfel war natürlich die Rückkehr des Priesters Donald Callahan aus „Salem’s Lot“, nach 28 Jahren. Die wohl längste Pause einer Figur, bis Danny Torrance 36 Jahre nach „The Shining“ als „Doctor Sleep“ in Erscheinung trat. Mit Callahans Einbindung in den Turm-Zyklus, so King, erübrigten sich auch stete Nachfragen nach einer Fortsetzung seines berühmten Vampir-Romans. Außerdem wird im „Wolfsmond“ erzählt, dass „Lot“-Protagonist Ben Mears in Mexiko längst unter der Erde liegt. „Ich bin keine Erfindung, oder doch?“, fragt der Geistliche, und bereit uns auf die nächste noch kommende, beeindruckende Meta-Ebene vor. Der Roman „Brennen muss Salem“ wird von den Romanfiguren entdeckt. Und damit kommt Stephen King als Gott-ähnlicher Schöpfer ins Spiel.
Stephen King als Romanfigur
Der fünfte Band wird damit auch zur Vorbereitung auf Stephen King als Romanfigur, der von Roland und seinem Ka-Tet tatsächlich einen Besuch in der echten Welt von Maine erhalten wird. King baute sich selbst ein, weil er seinen eigenen Kampf mit dem Turm darstellen wollte.Aals vermeintlich nicht zu stemmende literarische Aufgabe, oder, einfach ausgedrückt: Seine eigenen Charaktere müssen ihm in den Arsch treten. Damit er die Turm-Romane fünf bis sieben endlich zum Abschluss bringen würde.
Der Revolvermann und seine Freunde werden von einer Dorfgemeinschaft der Calla (= Grenzstadt) Bryn Sturgis engagiert, um die periodische Invasion der Wölfe genannten Reiter in ihr Dorf zu stoppen. Die Wölfe kidnappen aus unbekannten Gründen deren Kinder. Die später mit geistiger Behinderung zurückkehren.
„Bryn Sturgis“ ist ein Wortspiel aus dem Schauspieler Yul Brynner und dem Regisseur John Sturges, die 1960 gemeinsam „Die Glorreichen Sieben“ drehten. King liebt den Western, der wiederum auf Akira Kurosawas „Sieben Samurai“ beruht. „Wolves of the Calla“ wird so zu einer „Prepare for Battle“-Erzählung, die auch losgelöst vom Schlussspurt der finalen „Dark Tower“-Romane und der Suche nach dem Turm funktioniert. Eine sich selbst genügende Geschichte mit großen Fights also.
Hier trifft’s Eddie Dean
Dazwischen der erzählerisch gelungene Roboter Andy, King tut sich ja oft schwer in der Konzeption von KI-Figuren. Einem erstmals tanzend zu erlebenden Roland, dessen entfesselte Bewegungen wie mit dem Stones-Hit „Honky Tonk Women“ synchronisiert zu sein scheinen. Sowie eine Aufarbeitung des Kindheits-Traumas Kings, sich in der Natur den Hintern mit Brennnesseln abgewischt zu haben. Hier trifft’s Eddie Dean.
Es ist schön, den Priester Callahan zurückzuhaben. Wenn auch nur für kurze Zeit. Der vom Glauben abgefallene Priester galt ja nach seinem Vampirbiss für Jahrzehnte als verschollen. Nun klärt er mit Roland Deschain seine Vertrauensfragen. Aber auch eine andere wichtige. „Hatten die Red Sox endlich einmal die World Series gewonnen, als ihr Amerika verlassen habt?“
Stephen King – Das Ranking
-
Plätze 81-88
-
Plätze 80-71
-
Plätze 70-61
-
Plätze 60-51
-
Plätze 50-41
-
Plätze 40-31
-
Plätze 30-21
-
Plätze 20-11
-
Plätze 10-01