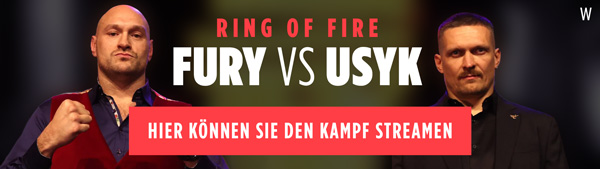Editors – An End Has A Start :: Interpol zeigen den Editors, wie Salon-Gotik richtig funktioniert
Es wäre nützlich, wenn wir einen Begriff für dieses Genre hätten, gerne auch einen doofen. Sonst muss man halt immer wiederholen, dass das die vielen Bands sind, die wie Joy Division und Echo & The Bunnymen klingen-was als Aussage unelegant ist, obwohl es bei Interpol aus New York oder den Editors aus Birmingham ja stimmt.
Was das genau ist? Eine Salon-Gotik. Gitarren-New-Wave für einen sehr feinen Grafen Dracula. Musik, die dem wangenknochigen Pathos der genannten Vorbilder so viel verdankt wie dem livrierten, feierlichen Chanson der Tindersticks. Und – wie man bei den Editors merkt
den flackernden Flammen von U2 und Coldplay (die ja selbst auch vom Joy Division-Sound herkommen).
Dass die Tränen, die von diesen Sängern hier so grimmig und würdevoll unterdrückt werden, keine Freudentränen sind wie bei Chris Martin, merkt man bei den Editors schon im ersten Lied. Da geht es um die Leute, die in der Raucherzone des Krankenhauses um ihre Liebsten zittern, und schneller als gedacht schwillt die Gitarre dabei zum jodelnden Himmelschor, breitet der blutige Samstag die Arme aus, sieht man die Stroboskoplichter blitzen.
Die Editors haben absolut bessere Chancen als Interpol, einen Hit zu landen. Unter anderem, weil ihre Songs so berechenbar verlaufen, weil jede einsam zum Disco-Beat jammernde Hookline gleich so wahnsinnig eingängig ist. Und weil trotz des ganzen Schmerzes, den der Sänger herbeizitiert, kein echter Grusel mehr hinter dieser Musiksitzt. Also: nette Platte, mehr nicht.
Ganz, ganz anders Interpol. Die größten Songwriter der Welt sind diese Dunkelmänner zwar nicht, die sich bei Konzerten immer von hinten beleuchten lassen, so dass man nur dürre Schatten sieht. Deshalb wollen wir auch nicht zu überschwänglich werden, obwohl diese Musik oft eine wahre Offenbarung ist, eine echte Lösung, wie der organverfettete Pathos-Rock insgesamt zu retten wäre.
Interpol machen irgendwie hörbar, wie es sich anfühlen muss, gegen die eigene Erdenschwere anzuspielen. Ihre Melodien schummeln sich über absteigende Skalen von Moll in Dur, ihre Stücke haben bei aller Strenge immer etwas faszinierend Widerwilliges, Heimliches, das die Harmonie so sehr zu suchen scheint wie die komplette Auflösung. Wie im satanischen Northern Soul „All Fired Up“ die zwei Gitarren gegeneinanderschlittern, ein schepperndes Riff gegen eine gleitende Linie, das setzt den ganzen Donner erst in den richtigen Kontext: Die Musik von Interpol ist eine Zerfallstudie, in der der aufrechte Sänger die gleiche Erzählerrolle füllt wie Lou Reed bei den Velvet Underground.
Also doch: Kein Grund zum Heulen.