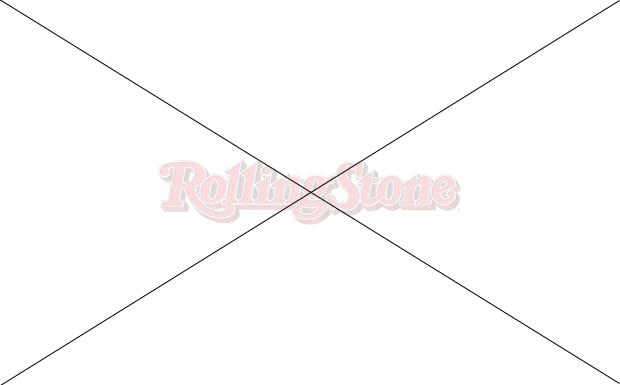Roskilde Festival, Tag 2: America, fuck yeah!
Jack White ist wieder da angekommen, wo er schon mal war: Mit seiner Ladies Band bespaßte er 40.000 Menschen vor der legendären Orange Stage. Vor allem die Acts, die über den großen Teich reisten, überzeugten an Tag 2. Neben White auch Gossip, Sage Francis und die Punch Brothers.
Sage Francis sieht heute mal aus wie – sagen wir – Butch Norton von den Eels. Oder wie Joe Pesci in der Rolle des Nicky Santoro in Scorceses „Casino“. Der wuchtige Rapper – einer der wenige White Boys, der dabei sein Hand- bzw. Mundwerk versteht – trägt über weite Strecken seiner One-Man-Show im Cosmopol-Zelt des Roskilde Festival eine silbergraue Perücke, die er erst nach einer halben Stunde wie einen gebrauchten Wischmopp in die Ecke feuert. Francis ist der letzte Act des nachmittäglichen HipHop-Specials im Cosmopol, das überwiegend für elektronische Acts reserviert ist – und es ist eine schreiende Ungerechtigkeit, dass Francis vor einem nur halb gefüllten Zelt spielt. „Do you like political HipHop?“, fragt er und erntet ein leises Jubeln und ein lautes Murren. „Yeah, me neither“, stellt er fest – und jault dann „But a man’s got to do what he has to do!“ Und, weiter geht’s mit seinem Sample- und Wort-Feuerwerk, in dem er dem amerikanischen Traum wieder und wieder ans Bein pisst. „I am from America, you know. The Land of the Free!“ Jubel – dann: „Yeah, you wouldn’t even know what that is!“ Und los geht es mit „Slow Down Ghandi“, souverän in die Reihen gespuckt: „When the music’s dead, I’ll have Ted Nugent’s head hangin‘ on my wall / Kill one of ours, we’ll kill one of yours /With some friendly fire, that’s a funny term, like civil war“. Am Ende der Nummer dröhnt dann plötzlich „America Fuck Yeah!“ durch das Zelt – ein bitterböser Song, der seinen Weg aus der Polit-Puppen-Satire „Team America“ in die Popkultur geschafft hat – und dabei für viele seinen Satire-Gehalt verloren hat. So spielt Kid Rock ihn zum Beispiel gerne mal – völlig unironisch. Hier passt er wieder, um so besser, weil Sage Francis dabei nicht nur seine wütenden Worte schnaubt, sondern auch noch so tut, als würde er Amerika von hinten nehmen. Kurz darauf dann noch versöhnliche Klänge, als Francis’ die Indie-Kids pleased und einen Song über einer 64-Bit-Version von „Where Is My Mind“ spielt.
Dieses „America, fuck yeah!“ kommt einem im Laufe des Tages wieder und wieder in den Sinn – vielleicht, weil es an diesem zweiten Tag des Roskilde oft die Acts aus Übersee waren, die auf ihre Weise überzeugten. Allen voran Jack White, der es mit seinem Headliner-Slot und seiner Vergangenheit natürlich am leichtesten hatte. White Stripes-Hits und den einen Hit von den Raconteurs kennt schließlich jeder – und die Tatsache, dass er all diese Songs spielt, weil er sie eh geschrieben hat und weil sie überwiegend von seiner Gitarre und seiner Stimme leben, hat inzwischen jeder akzeptiert. Dennoch war es vor allem Whites sympathisches Aufgekratztsein, das seinen Gig zu etwas Besonderem machte. Man darf ja nicht vergessen, dass er zwar schon mal auf den Festivalriesen wie Rock am Ring, Reading und Glastonbury Headlinerslots gespielt hat, aber seine aktuelle Tour führt ihn eher durch große Clublocations, und nicht unbedingt vor 40.000 Menschen und auf eine Bühne, die schon die ganz großen gesehen hat. Konzentriert, zappelig, bescheiden lächelnd und mit einer sichtbaren Ergebenheit in die Tatsache, dass sein Erfolg von einer Musik lebt, die gespielt wurde, als seine Eltern ihn noch längst nicht geplant hatten – so zeigte sich White an diesem Abend, und wurde nicht nur von der geballten Euphorie des Publikums belohnt sondern auch noch mit einem famosen Sonnenuntergang im Rücken. Wobei White sagte, als es dann dunkel wurde: „Isn’t it great to play music in the dark? I love it!“ Man sah es ihm an – und auch seiner Band, über die man viele Worte verlieren sollte. White ist ja mit zwei kompletten Bands auf Tour – einer Herrenbelegschaft und einer famos aufspielenden Damenbesetzung. Wer glaubt, diese Damen stünden für eine weiche Note und hätten besänftige Wirkung auf die oft fickerigen White-Songs, wurde schnell eines besseren belehrt: Das gilt höchstens noch für die Einsätze von Background-Sängerin Ruby Amanfu, aber der Rest der Ladies sorgt für einen rockigen Sound, der optisch und akustisch gleichermaßen Freude macht. Vermisst man da Meg White? Klar, irgendwie schon, aber eher aus nostalgischen Gründen, wenn bei „Hotel Yorba“ die Geschichte der beiden mitschwingt. Ansonsten ist es eine wahre Freude, Carla Azar zu bestaunen, die sich White von ihrer Band Autolux geborgt hat. Wie sie bei „Love Interruption“ für Furor sorgt, bei „Missing Pieces“ die Percussions-Unterstützung in Grund und Boden spielt und White bei „Steady As She Goes“ geradezu voranschiebt – das war schon ganz schön „Wow!“. Das Ende des Sets nach gut anderthalb Stunden wurde wie erwartet mit jenem Song bestritten, den man noch vor wenigen Woche bei jedem zweiten EM-Spiel im Stadion hörte. Aber es war dann doch erstaunlich, was dieser Song für eine Kraft entwickelt hat, wie er es schafft, jeden in Hörweite zur Bühne zu ziehen, wie das berühmte Bassriff, das keines ist, von zehntausenden aufgegriffen und „mitgesungen“ wird. Selbst White scheint seinen Frieden damit gemacht zu haben, als er diese Menge im Licht der Scheinwerfer vor sich wogen sieht. Fast beschämt ob der Ekstase verneigt er sich mit seinen Ladies und geht winkend von der Bühne. Abgewichst war an dieser Show so gar nichts.
Um den Titel dieses Nachberichtes zu rechtfertigen seien hier nun noch Lee Ranaldo, The Gossip und die Punch Brothers erwähnt. Letztere spielten im direkten Anschluss zu White im kleinen Pavillon-Zelt und hatten einen ähnlichen Lehrauftrag wie Jack White. Junge Menschen, die sich zu Banjo- und Mandolinen-Klängen wiegen, die fiedelnde Herren im Bluegrass-Rausch bejubeln und ekstatische Aufschreie, als Chris Thile dem Yodel fröhnt und eine Hohelied auf Jimmy Rogers singt – wann erlebt man das schon mal? Die Leidenschaft, mit der die Punch Brothers diesen alten und oft als uncool verschrienen Klängen nacheifern, und wie sie das mit Traditionsbewusstsein aber sehr junger Euphorie in die Jetztzeit bringen, das ist sehr schön anzusehen – und lässt einen die Erkenntnis, dass in der Musik alles irgendwie irgendwo schon mal da gewesen ist, geradezu versöhnlich erscheinen. Thile und seine Herren hatten diesen Empfang wohl so nicht erwartet: „Hey, nobody told us we should go to Denmark. You’re amazing!“ Ein schönes Kompliment zur Nachtzeit.
Früher am Abend versuchte sich Beth Ditto schon im Dänischen, gab aber zu, dass sie außer „tusind tak“ und das dänische Prost „Skål“ nichts Dänisches sprechen kann. Letzteres grölte sie immer wieder gut gelaunt in die Menge, wobei es bei ihr nach „Skooooooooo“ klang. Ihre Show war dabei wie immer mitreißend und ein Stinkefinger gegen jene, die meinen, Gossip hätten sich ausverkauft und wären nur noch Mainstream-Murks. Selbst wer ihr letztes Album verschmäht, musste hier feststellen, dass die Damen und Herren, die live inzwischen zu fünft spielen, eine tolle Live-Band sind. Und, ja, man muss das auch mal sagen, weil man ja auf Fotos immer nur die Momente sieht, in der Ditto frei dreht und das Publikum herzt oder ihren Körper in alle Richtungen wirft: Irgendwie ist sie eine Süße. Diese Wärme, die aus ihren Ansagen und Witzen spricht, dieses freundlich und ja auch hübsche Gesicht, diese Kraft, die aus ihr heraus röhrt, wenn sie dann ins Singen gerät – wäre schön, wenn man das auch mal in ihr sieht und sie nicht nur immer als die überexzentrische Wuchtbrumme deklariert, die sie sie gar nicht ist. Und, was den Sellout angeht: Gleich der zweite Song war ein Bikini-Kill-Cover und ein deutliches Zeichen, dass man nicht vergessen hat, wo man her kommt. Letzteres ließ sich dann auch bei Lee Ranaldo feststellen, der sein Soloalbum mit Routine und Bock auf die neue Freiheit ins Odeon-Zelt spielte und dabei immer wieder Details zu seinen Songs zum besten gab. Zum Beispiel die Geschichte zu „Xtina As I Knew Her“. Dass er mal mit Feedbackgöttern musiziert hatte, hörte man in seinem Set jedoch auch immer wieder heraus.
Bevor uns jetzt jemand vorwirft, man hätte sich nur auf die Amis konzentriert: Es gab natürlich noch anderes aus anderen Ländern zu entdecken. Die Britin Elena Tonra alias Daughter zum Beispiel, die in ihrer Jugend, die noch nicht so richtig vorbei scheint, viel Cat Power gehört haben wird. Viele ihrer Songs haben noch nicht dieselbe Kraft, aber wie sie bei „Landfill“ singt „I want you so much but I hate your guts“, während die Drums düster klopfen – da konnte man sich auch im randvollen und warmen Gloria-Zelt nicht gegen die Gänsehaut wehren. Unverständlich blieb dann jedoch der Anblick beim letzten Gig auf der Orange Stage. Da merkte man dann mal wieder, dass man in einem anderen Land ist, in dem man so manches nicht kapiert. Vor ähnlich voller Wiese wie Jack White spielten Malk De Koijn, ein dänisches HipHop-Trio, dass als DER Act des Tages angepriesen wurde. Und was verbarg sich dahinter: Textlich leider schwer zu sagen, musikalisch erinnerten die ersten Minuten jedoch bitter an die „Die Da“-Phase der Fantastischen Vier – und das leider auch optisch.
So ging man dann also mit einem leicht schlechten Gewissen ins Zelt. Man wollte es ja verstehen, man ist ja schließlich dankbarer Gast und begeistert von Land und Leuten, aber das ging dann nun wirklich nicht. Aber am Ende ist das ja auch egal: Man muss ja nicht den lokalen HipHop verstehen, um zu erkennen, dass man noch immer auf einem Festival ist, dessen Gastfreundschaft legendär ist.
–
www.rollingstone auf dem Roskilde: