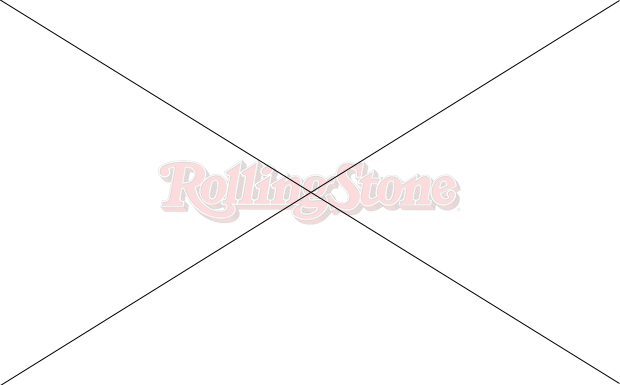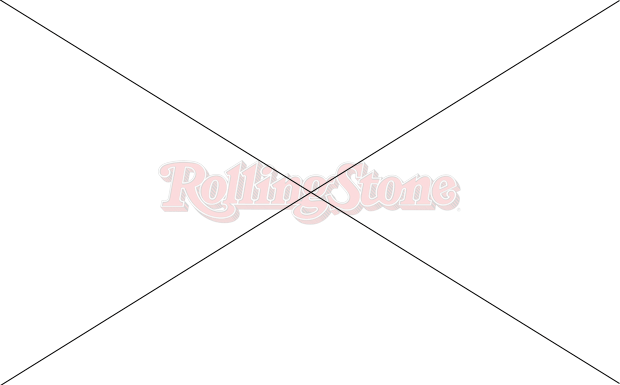Serienhelden: Die Liste der Unsterblichen
Die Redaktion hat sich gequält - und am Ende gewählt: Tony Soprano ist unser größter Serienheld, dicht gefolgt von J.R. Ewing aus Dallas und Inspektor Columbo. Hier finden Sie unsere Texte zur Liste der unsterblichen Serienhelden.
Warum fehlt hier eigentlich so viel? Schon vergessen, wie unterhaltsam die Dialoge bei „Ich heirate eine Familie“ waren? Oder wie gemein der Humor von „Roseanne“? Sind die Lesben von „The L Word“ etwa nicht schön genug? Und war James Woods als gnadenloser Anwalt „Shark“ wirklich selbst schuld, dass seine Serie nur so kurz lief? Warum ist unser Lieblings-Indie-Kid Seth Cohen („O.C., California“) nicht dabei, und wissen nicht längst alle hier in Deutschland, wie toll „Curb Your Enthusiasm“ oder „Being Erica“ sind? Der eine ist entsetzt, dass Manfred Krug es mit „Auf Achse“ nicht in die Top 70 der Serienhelden geschafft hat, der andere weint immer noch Ekel Alfred, „Unserem Lehrer Dr. Specht“ oder „Praxis Bülowbogen“ hinterher. Und dann kommt plötzlich die Volontärin an und fragt: „Was ist denn mit ,Buffy‘?“
70 Serienhelden (die vollständige Liste finden Sie in unserer aktuellen Ausgabe) – das klingt nach einer Menge, aber unser Leben besteht aus einer viel größeren Menge Fernsehen, und Serien sind das Allerschönste am Fernsehen. Ein Spielfilm ist wie eine Amour fou – eine heftige Affäre für zwei Stunden, die vielleicht länger nachwirkt und möglicherweise mal wiederholt wird, aber eine Serie – das kann eine jahrelange Liebesbeziehung werden. Bei einer wie „Emergency Room“, auch in Deutschland gern liebevoll „ER“ abgekürzt, die über 15 Staffeln läuft, kennt man das Personal nach einer Weile so gut, dass man die Leute grüßen würde, wenn sie einem auf der Straße begegneten. „Hi, Abby, alles wieder gut mit Luca?“ Man leidet mit, man kämpft mit, man beschäftigt sich mit den Sorgen dieser Menschen, die es gar nicht gibt, weil sie einen berühren und das eigene Leben für ca. 50 Minuten in den Hintergrund treten lassen. Eine Erleichterung.
Die Begeisterung für eine Serie – das ist wie eine lange Leidenschaft für eine Band, ohne die man sich die Welt kaum vorstellen kann. Man kann Adele bewundern oder James Blake, aber es wird noch lange dauern, bis sie einem so viel bedeuten wie die Musiker, deren Karriere man seit Jahrzehnten verfolgt. Bob Dylan, Bruce Springsteen, U2 – sie sind das musikalische Äquivalent zu „ER“, „House“ und den „Sopranos“. Wir können Dialoge zitieren, wie wir Songzeilen zitieren können, und ob das eine mehr Eskapismus ist als das andere, kommt auf die Situation an.
Vor dem Einschlafen gibt es nichts Schöneres als „Die Nanny“, sie wiegt einen mit ihrer Kreischstimme und dem harmlosen Humor herrlich in den Schlaf. Wobei Ted Dansons zynischer „Becker“ auch funktioniert, weil man sich dank der sparsamen Sets – der Großteil spielt sich im Café oder in der Praxis ab – sofort zu Hause fühlt. Alle sind fies zueinander, und doch spürt man, wie gern sie sich haben. Arztpraxen und Krankenhäuser, Schulen und Kneipen, FBI und Polizei: Das sind die klassischen Serienorte. Der Flughafen wurde leider noch nicht entdeckt und das Gastgewerbe zuletzt auch sträflich vernachlässigt. Es bleibt ein Rätsel, warum nur so wenige Zuschauer ins glamouröse „Hotel Babylon“ einchecken wollten – eine der besten BBC-Serien der vergangenen Jahre.
Viele Serienfreunde sind ohnehin längst dazu übergegangen, gleich komplette Staffeln in DVD-Boxen zu bestellen, statt darauf zu warten, dass die Serien nach Deutschland kommen. Die lästige Diskussion um die Qualität der Synchronisationen (die oft besser sind als ihr Ruf) entfällt dann. Aber: Es entfällt auch die schöne Spannung, die sich jeden Mittwoch einstellt, bis es endlich 20:15 Uhr ist. Oder Dienstag, 21:45 Uhr: Noch heute weiß doch jeder, der in den 80er-Jahren aufgewachsen ist, wann „Dallas“ lief (und ab welchem Alter er es endlich nicht nur in den Ferien anschauen durfte). Oder wie man in den 90er-Jahren die Samstage verbracht hat – mit „Beverly Hills, 90210“. Und so weiter.
Wie also haben wir letztendlich die 70 Serienhelden ausgewählt? Unter Schmerzen! Auf Kinderkram haben wir verzichtet und auch auf alle Zeichentrickserien – bis auf die gelben Männchen, die wie keine anderen die Popkultur mitgeprägt haben. Gegen die Simpsons hatten Wickie und Biene Maja, Tom & Jerry und Popeye natürlich keine Chance, und auf „South Park“ pfeifen wir auch. Obwohl: Den Maestro aus „Es war einmal …“ hätte ich gern einmal wiedergesehen! Oder Grisu … Schlaubi … Beavis & Butthead …
Lose Reihen, die keine durchgehende (Hintergrund-)Handlung haben, mussten ebenfalls wegfallen, also kein „Traumschiff“, „Derrick“ oder „Tatort“. Und mehr als ein halbes Dutzend Folgen sollte es schon geben, sonst gilt es nicht als Serie – es sei denn, die Episoden sind dermaßen sensationell wie die von „Kir Royal“, dann werfen wir die Regeln schon mal über Bord, wie das Baby Schimmerlos bei schwierigen Aufträgen auch immer gemacht hat. Zu viele Skrupel verderben die Laune. Mag ja sein, dass viele „C.S.I.“ in sämtlichen Variationen gucken, aber wenn sich keine(r) so dafür begeistern kann, dass es nominiert wird – dann raus damit. So fielen auch einige der klassischen „Frauenserien“ durchs Raster: „Brothers & Sisters“ war doch zu pathetisch, „Cougar Town“ zu hysterisch, die „Gilmore Girls“ vielleicht nur zu lange her. Moment mal, mag man einwenden, aber „Friends“ ist nicht zu albern? Kann schon sein, doch jeder Zweite wollte plötzlich über Chandler Bing schreiben, der in all den Jahren zu einer Art virtuellem Nachbarn geworden ist, den man in letzter Zeit nur nicht mehr so häufig sieht. Das macht eine gute Serie aus: Sie gehört einfach zum Leben dazu. Und wer trotzdem noch unter dem Fehlen von diesem oder jenem Helden leidet, der muss sich wohl mit Dr. House trösten: „Wie schon einmal ein berühmter Philosoph namens Mick Jagger sagte: You can’t always get what you want!“