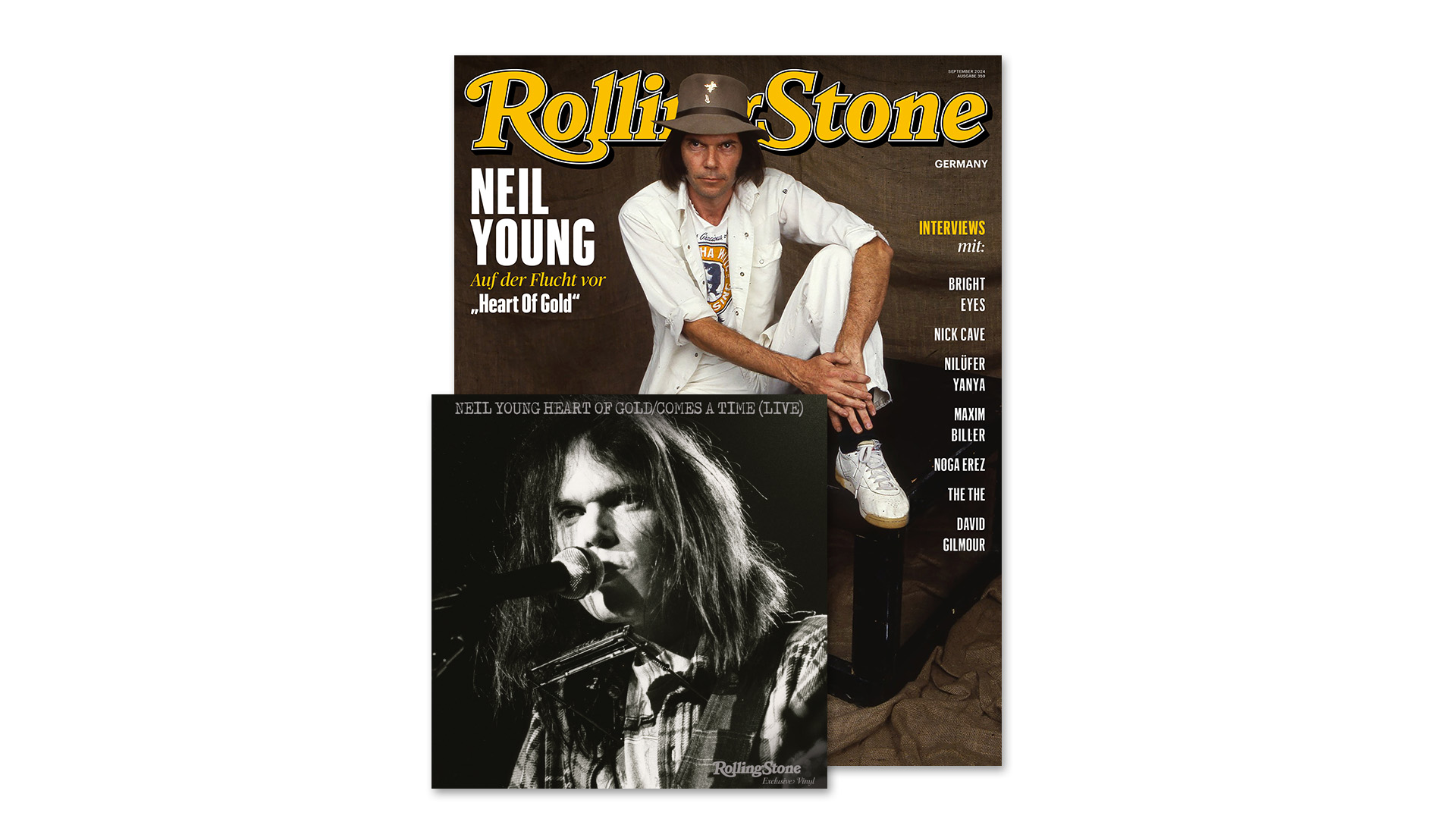Conor Oberst
Conor Oberst
Life is a journey, not a destination“, sagte der Philosoph Steven Tyler. Conor Oberst lebt danach, und wenn einer eine Reise tut, hat er bekanntlich viel zu erzählen. Es beginnt in „Cape Canaveral“ und geht weiter mit einem klassischen Aussteiger-Traum: nach Sausalito ziehen, sich auf einem Hausboot vom Ozean schaukeln lassen – „there’s no sorrow that the sun’s not going to help“. „Sausalito“ erinnert etwas an „Classic Cars“ vom letztjährigen Bright Eyes-Album „Cassadaga“, und im Grunde klingt „Conor Oberst“ wie die Fortsetzung mit etwas anderen Mitteln. Strenggenommen ist es auch gar nicht Obersts Solo-Debüt, denn drei Alben hat er schon im Alter von 13 bis 15 aufgenommen. Nun waren die Mystic Valley Band und Andy LeMaster bei den Aufnahmen in Tepoztlán/Mexiko dabei, aber: Was immer auf dem Etikett steht, am Ende ist stets vor allem Conor Oberst drin.
Spätestens bei „Get-Well-Cards“ fällt dann allerdings auf, dass er diesmal noch viel ungenierter auf Gitarren setzt – richtige Country- und RockGitarren, nicht die Indie-Ironie-Version davon. Seine Stimme, die sich nagend und verzweifelt ins Herz beißt, wird ihn dabei immer vom Mainstream absetzen, und seine Vorstellung von einem Liebeslied ist auch eine eher seltsame: „I want to be your bootlegger/ Want to mix you up something strange/ Braid your hair like a sister/ Name you like a hurricane.“
„Danny Callahan“ schlägt in eine ähnliche Kerbe und zeigt nebenbei mal wieder, dass Oberst die Kunst des Aperçus beherrscht wie keiner seiner Altersgenossen: „Some wander the wilderness/ Some drink cosmopolitans“ – das Schisma der Welt in zwei Sätzen. Ungefähr. Bei „I Don’t Want To Die (In A Hospital)“ wird es vielleicht ein bisschen zu viel mit dem Schwung, den Gitarren und dem Piano, dann singt auch noch Janet Weiss mit. Andererseits: Wer hätte bei solch einem Titel so ein schnelles Stück erwartet? Im nächsten Moment ist wieder alles still, nur die tremolierende Stimme erzählt vom „Eagle On A Pole“. Eine Anklage, ohne die ausufernden Textlawinen von einst. Heutzutage beschränkt sich Oberst auch mal auf das Entscheidende.
„NYC-Gone, Gone“ beginnt fast wie J. Geils‘ „Centerfold“ – oder ein irisches Sauflied, auf jeden Fall albern, und hört dann auch gleich wieder auf, es folgt das Herzstück des Albums, „Moab“. Eine unwiderstehliche Melodie, eine Geschichte von der Suche nach Liebe oder zumindest einem Platz, an dem es besser ist als hier. Die Tournee mit Springsteen ist offensichtlich nicht spurlos an Oberst vorbeigegangen. „There’s nothing that the road cannot heal“, behauptet er.
Es ist eine Reise ohne sicheres Ziel, und keiner weiß, ob die Straße überhaupt je enden wird. Aber besser den Aufbruch wagen, als ewig in einer town full of losers hocken zu bleiben. Solange Conor Oberst weiterhin so viele erstaunliche Orte entdeckt, setze ich mich im Bus gern neben ihn. Im abschließenden „Milk Thistle“, nur mit ein bisschen Gitarre und Bass untermalt, gibt es auch gar keine andere Wahl, als immer weiterzuziehen: „If I go to heaven/ I’ll be bored as hell/ Like a little baby/ At the bottom of the well.“ (Wichita/Cooperative)