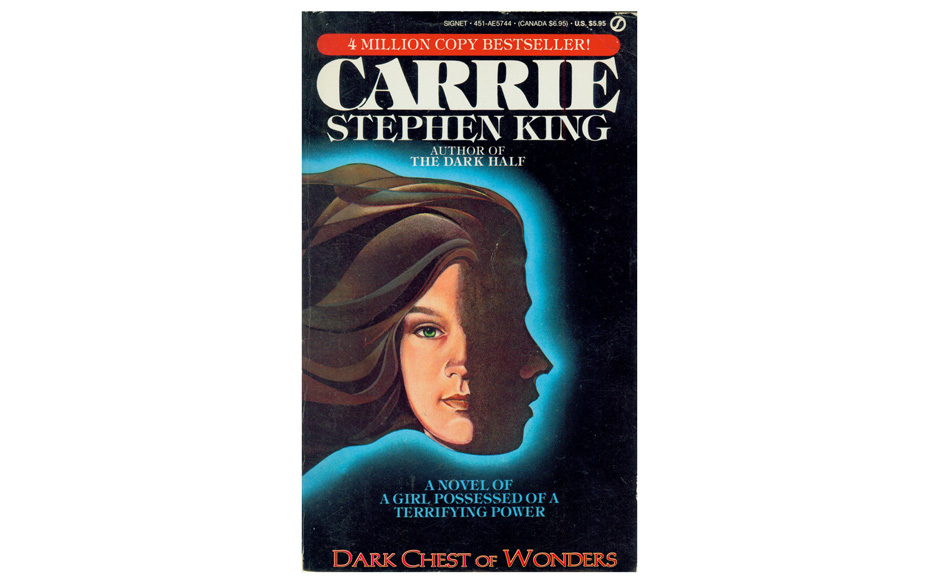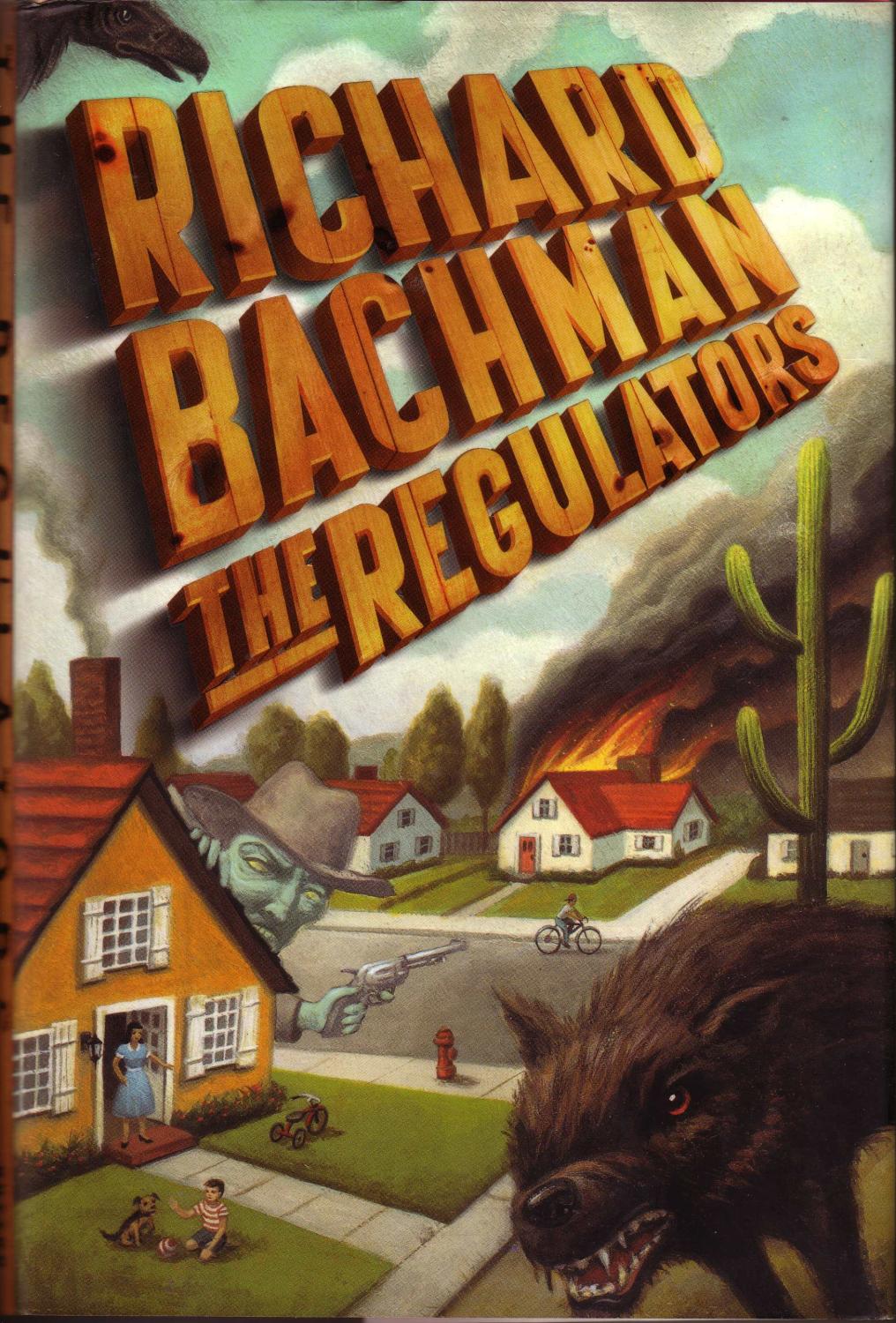Stephen King: Die besten Bücher – Plätze 40-31
Stephen King: Alle Romane, Kurzgeschichten und Novellen-Sammlungen im Ranking. Sehen Sie hier die Plätze 40-31.
Stephen King – Das Ranking
-
Plätze 81-88
-
Plätze 80-71
-
Plätze 70-61
-
Plätze 60-51
-
Plätze 50-41
-
Plätze 40-31
-
Plätze 30-21
-
Plätze 20-11
-
Plätze 10-01
40. The Dark Tower I: The Gunslinger (1982, deutsch: „Schwarz“) ★★★½
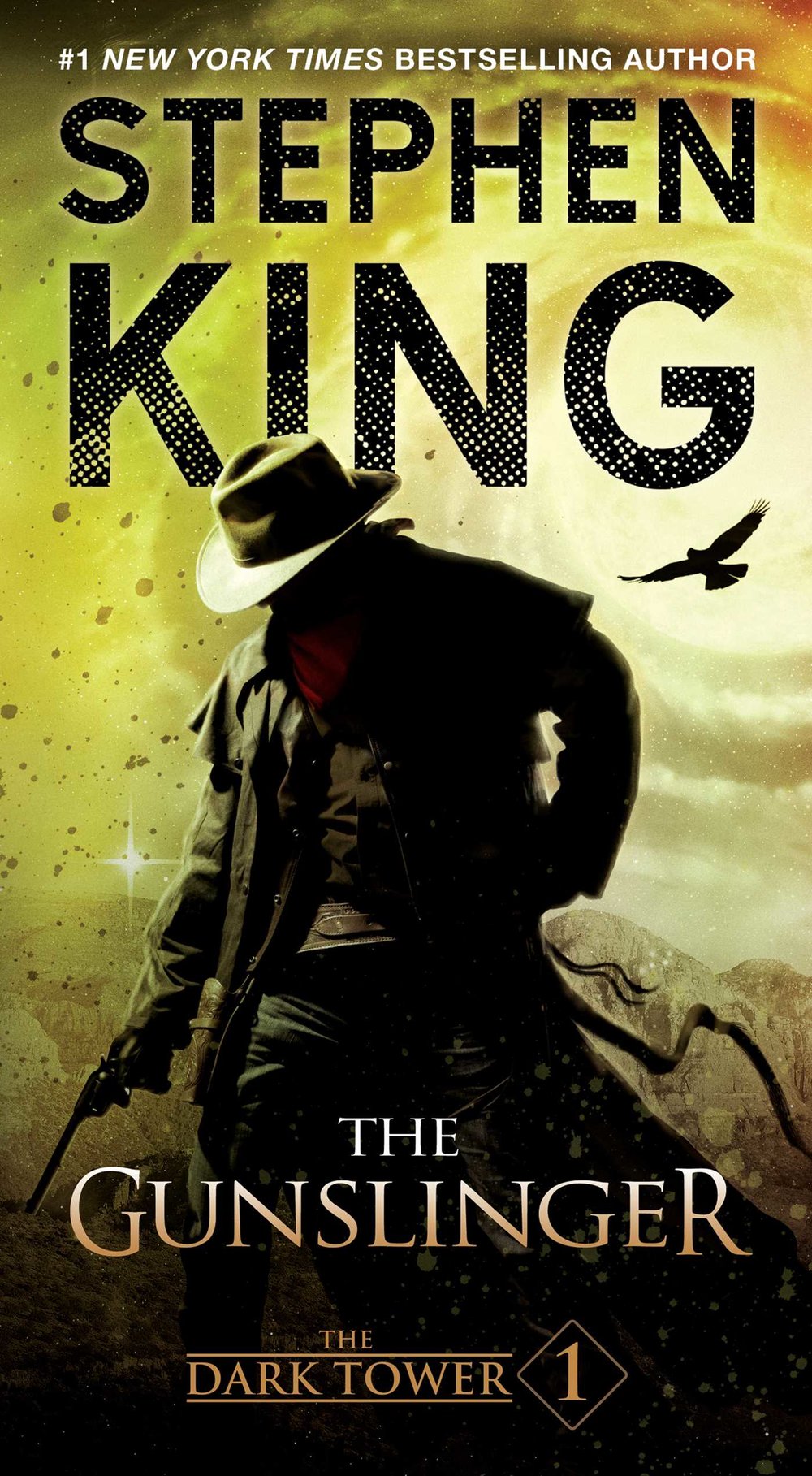
Stephen King: Die besten Bücher – Plätze 40-31. King nennt den „Dunklen Turm“ sein Magnum Opus: Die Jagd des Revolvermanns Roland Deschain nach dem Mann in Schwarz, Randall Flagg, und die Suche nach dem geheimnisvollen Turm, und was sich dahinter verbirgt, sollte den Schriftsteller in sechs weiteren Bänden bis 2003 beschäftigen. Leser hatten ihn immer wieder über die Jahre bedrängt – wie geht die Geschichte weiter?
Und er ließ sich immer mehr Zeit. Als King dann 1999 beinahe einem Verkehrsunfall erlegen wäre, sei ihm diese Frage wieder bewusst geworden. Und was aus dem „Turm“ geworden wäre, hätte er die Saga nicht zu Ende schreiben können.
Die von King im Jahr 2003 erweiterte und revidierte Fassung gleicht die Erzählung den Geschehnissen in den Büchern zwei bis sieben an; ursprünglich war „The Gunslinger“ ein Sammelband aus fünf zwischen 1978 und 1981 veröffentlichten Kurzgeschichten.
Mit dem Westernhelden Roland und seinem Antagonisten Flagg hat King zwei seiner charismatischsten Figuren geschaffen, der Held ist ein schweigsamer Soldat, der seiner Aufgabe jegliches Gefühl, auch gegenüber Mitmenschen, unterordnet. Flagg, der uns in Kings Universum noch etliche Mal begegnen würde oder schon begegnet ist, ist ebenso Verführer wie Choleriker – immer dann, wenn ihm Grenzen aufgezeigt werden.
„Schwarz“: wie doof!
Roland durchstreift die Wastelands in einem Paralleluniversum, mit Cowboystädten, Monstern und durchgedrehten, autonomen Zügen, auf der Suche nach Gefährten, die ihm seinem Ziel immer näher bringen. „Schwarz“ – ja, so heißt das Buch in der deutschen Übersetzung. So knapp, so doof, oder?
Das Jahr 1982 sollte den Auftakt bilden zu einer Reihe übel übersetzter King-Titel. „The Drawing Of The Three“ wird „Drei“, „Misery“ zu „Sie“ (ein Jahr zuvor gab’s schließlich das Erfolgsbuch „Es“), die „Tommyknockers“ werden zum „Monstrum“ (dabei kommt im Roman nicht ein einziges lebendiges Monster vor).
Den Gipfel des Unsinns würde 2006 „Lisey’s Story“ erreichen, das der deutsche Verlag als „Love“ herausbringt. Wenn man dem hiesigen Leser schon nicht das Verständnis längerer Buchtitel zutraut – warum dann so tun, als beließe man ihn im englischsprachigen Original?
39. Danse Macabre (1981, deutsch: „Danse Macabre – Die Welt des Horrors“) ★★★½
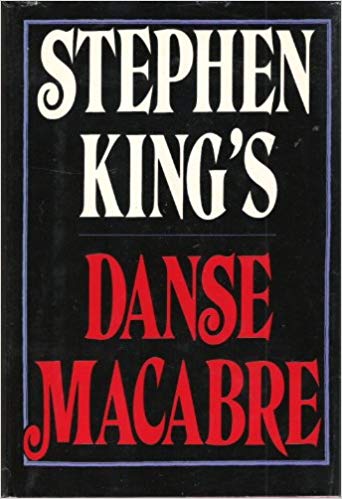
Stephen King: Die besten Bücher – Plätze 40-31. Keine 34 Jahre alt, schon wurde Stephen King gebeten ein Standardwerk über Horror-Literatur und -Kino zu schreiben. Sein erstes Sachbuch. Zwar gelingt es King gar nicht darzulegen, was uns gruseln lässt, Vampire, Werwölfe, Zombies? – aber wer kann das schon. Das Unterbewusste bleibt nunmal unergründlich, jeder kann erzählen, wovor er sich am meisten fürchtet – doch wer kann einem anderen schon erklären, warum genau?
King geht vorsichtshalber in die Defensive, er betont mehrmals, dass sein Agent ihn zu diesem Buch habe überzeugen müssen.
Im Grunde referiert Stephen King über seine Lieblingsfilme, darunter Slasher-Trash wie „Tourist Trap“, aber auch Cronenbergs „The Brood“ von 1979, an dem ihm weniger der Horror interessiert als die Schilderung einer Mittelschichts-Familie, die ins soziale Elend abzudriften droht.
Du liebe Güte
Etwas ergiebiger sind die Passagen über literarische Einflüsse. Lovecraft natürlich, an dem sich King wohl am deutlichsten erst mehr als 30 Jahre später, in „Revival“, orientieren würde. So wie die Märchenhaftigkeit von Ray Bradbury, der von ihm bewunderte Existenzialismus von Richard Matheson („The Shrinking Man“), als auch Peter Straub, ein Autor gleicher Generation, dessen „Ghost Story“ er ausführlich beschreibt und als neuen Maßstab für Geschichten mit Geisterhäusern sieht.
Interessant ist sicher das späteren Auflagen beigefügte neue Vorwort von 2010. Kings Filmgeschmack hat sich auch aufs Popcorn-Kino erweitert, ihm gefallen „Jeepers Creepers“ und „The Descent“ recht gut. Du liebe Güte.
38. Carrie (1974) ★★★½ 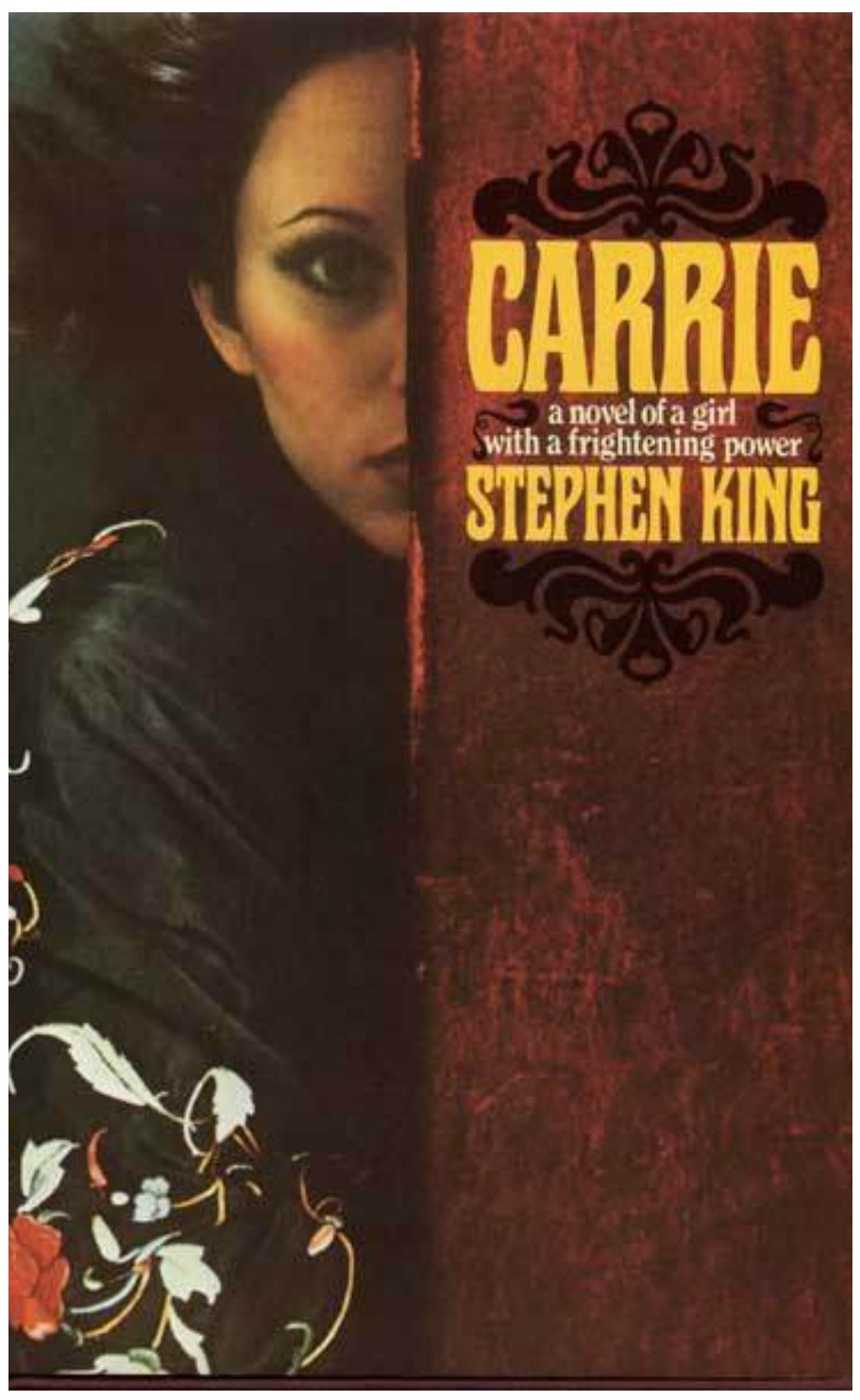
Stephen King: Die besten Bücher – Plätze 40-31. Kings Debütroman ist in Wirklichkeit sein vierter, allerdings der erste veröffentlichte. Die pubertierende Carrie White sollte eine der typischsten Figuren in Kings Universum werden: eine mit übernatürlichen Fähigkeiten ausgestattete Außenseiterin, die über ihre Feinde hinauswächst.
Carrie diente – hässlich, dick und wohl leider auch nicht sehr intelligent – zumindest als halbwegs adäquates Abziehbild jener Teenager in den Siebzigern, die von Love, Peace und Happiness nicht mehr all zu viel hielten, und die dennoch ihre Eltern verteufelten, deren moralisches Getue und übertriebene Religiösität.
King selbst betonte, dass William Peter Blattys Roman „The Exorcist“ als auch dessen Verfilmung von 1973, die ebenso die Rebellion des Nachwuchses abbilden, ihn nicht beeinflusst hätten.
All das macht „Carrie“ zu einem Roman, dessen Bedeutung für seine Zeit wahrscheinlich noch höher einzuschätzen ist als seine tatsächliche literarische Qualität. Der deutsche Filmtitel „Carrie – des Satans jüngste Tochter“ hat zwar einen heutzutage in der Industrie arg vernachlässigten Genitiv-Filmtitel, verkennt jedoch die Thematik. Mit Satan hat Carrie nichts zu tun. Sie ist ein Opfer. Es ist ihre Adoleszenz, die Periode, die zu den Schwankungen führt. Vor seiner Schriftsteller-Karriere arbeitete King als Lehrer. Er hat mitbekommen, was Mitschüler anderen Mitschülern antun können.
Zwitter aus Roman und Doku-Fiktion
Hier jedenfalls bringt Carrie am Ende ihre wahnsinnige Mutter um, die ihr Tochter am liebsten als Jungfrau konservieren würde. Das böse Ende der Matriarchin ist sowohl King gelungen, als auch Regisseur Brian De Palma, der „Carrie“ zwei Jahrs später ins Kino bringen sollte. Im Film wird Margaret White (Piper Laurie) ausgerechnet von Kruzifixen durchbohrt, die Carrie telepathisch abfeuert. Der Roman ist nicht minder brutal – darin redet die Tochter mantra-artig auf Mama ein und verlangsamt damit deren Herzschlag bis zum Stillstand.
Im Gegensatz zur Hollywood-Version, in der Carrie (Sissy Spacek) zumindest Mitgefühl erregt, bleibt man zum Roman-Charakter in erstaunlicher Distanz; vielleicht, weil sie sich selbst kaum in den Mittelpunkt stellt und die wenigen Hilfestellungen ihrer Mitschüler kaum zu nutzen weiß. Stattdessen werden Sue Snell und Tommy Ross zu Identifikationsfiguren.
Möglicherweise war Stephen King sich selbst nicht darüber im Klaren, wie er „Carrie“ am besten erzählen sollte. Er entschied sich für eine bisweilen sperrig zu lesende Zwitterform aus Roman und Doku-Fiktion, anhand von Zeitungsberichten, die vom mörderischen Treiben der übersinnlichen Carrie berichten.
Amokläufer Eric Harris und Dylan Klebold
Bereits in seinem Debüt aber dreht King die Story so, dass es nicht nur einzelne Personen, sondern eine ganze Gemeinschaft ist, von der das Schlechte Besitz ergriffen hat. Am Ende fliegt, den Nachbarorten Derry („It“) und Haven („The Tommyknockers“) sollte es später ähnlich ergehen, fast die ganze Stadt Chamberlain in die Luft.
Ein Jahr nach Veröffentlichung hatte der 28-Jährige von seinem Roman mehr als eine Million Taschenbücher verkauft. Der Mann, der in einem Wohnwagen zuhause war, war nun ein gemachter Schriftsteller. Sein Frieden mit Carrie hat er jedoch nie gemacht. Er mochte sie nicht, schrieb er in seinen Memoiren „On Writing“, sie sei vom selben Schlag wie die Amokläufer Eric Harris und Dylan Klebold.
37. Gwendy’s Button Box (mit Richard Chizmar, 2017, deutsch: „Gwendys Wunsch-Kasten“) ★★★★
Stephen King: Die besten Bücher – Plätze 40-31. Geburtstag und Weihnachten gleichzeitig! So muss sich Richard Chizmar gefühlt haben, als ihn sein Freund Stephen King bat, bei dieser Geschichte weiterzuhelfen. Chizmar ist Schriftsteller und Verleger des „Cementary Dance“-Verlags, der einige wunderschöne King-Editionen aufgelegt hat.
In dieser Novelle geht es zurück nach Castle Rock, in die 1970er-Jahre. Die 12-jährige Gwendy wird von einem Fremden angesprochen, der ihr den „Wunschkasten“ schenkt. Im Laufe der Jahre erfährt die Schul-Außenseiterin, dass Knopfdrücke nicht nur sie und ihr eigenes Leben verändern, sondern auch das Weltgeschehen.
Das Ding erinnert, mit den ausgeworfenen Schokotalern, also der Belohnung, fast an ein Pawlowsches Gerät. Sie geht mit ihrem Finger über die Landkarte, fragt sich, auf welchem Kontinent sie ihre Experimente durchführen könnte. Eher im spärlich besiedelten Australien? Schließlich sind die Länder Südamerikas, quasi Entwicklungsländer, schon gestraft genug …
Spiele Trump!
Was würden wir, was würde ein noch recht unerfahrenes Mädchen tun, könnte es von einer Sekunde zur anderen die Abläufe auf den Kopf stellen? Gwendy fragt ihre Lehrerin, ob es Menschen oder ein ganzes Land gebe, durch dessen Auslöschung die Welt besser werde. Schon wird im Unterricht darüber diskutiert, ob es nicht gut wäre, könnte man Russland und Vietnam von der Landkarte tilgen. Gwendy weiß, dass sie eine ähnliche Macht hat wie die Kalten Krieger – per Knopfdruck die Atomwaffen losschicken.
Natürlich wird Gwendy gewissermaßen eine Süchtige. King und Chizmar sezieren das hierarchische System amerikanischer High-School-Schüler, in denen nur die Schönsten und Sportlichsten oben stehen – die dickliche Teenagerin entwickelt sich zu einem Objekt der Begierde. Aber die „Was wäre, wenn …?“-Verantwortung hinterlässt auch Schäden. Das Eagles-Poster von „Hotel California“, zum Geburtstag bekommen, verdeutlicht Gwendys Dilemma: „You Can Check Out Any Time You Like, But You Can Never Leave“. Weltpolizei spielen. Einmal und dann immer wieder.
Nicht auszudenken, was jemand wie Trump mit so einem „Wunschkasten“ anstellen würde.
36. „Gerald’s Game“ (1992, deutsch: „Das Spiel“) ★ ★ ★ ★
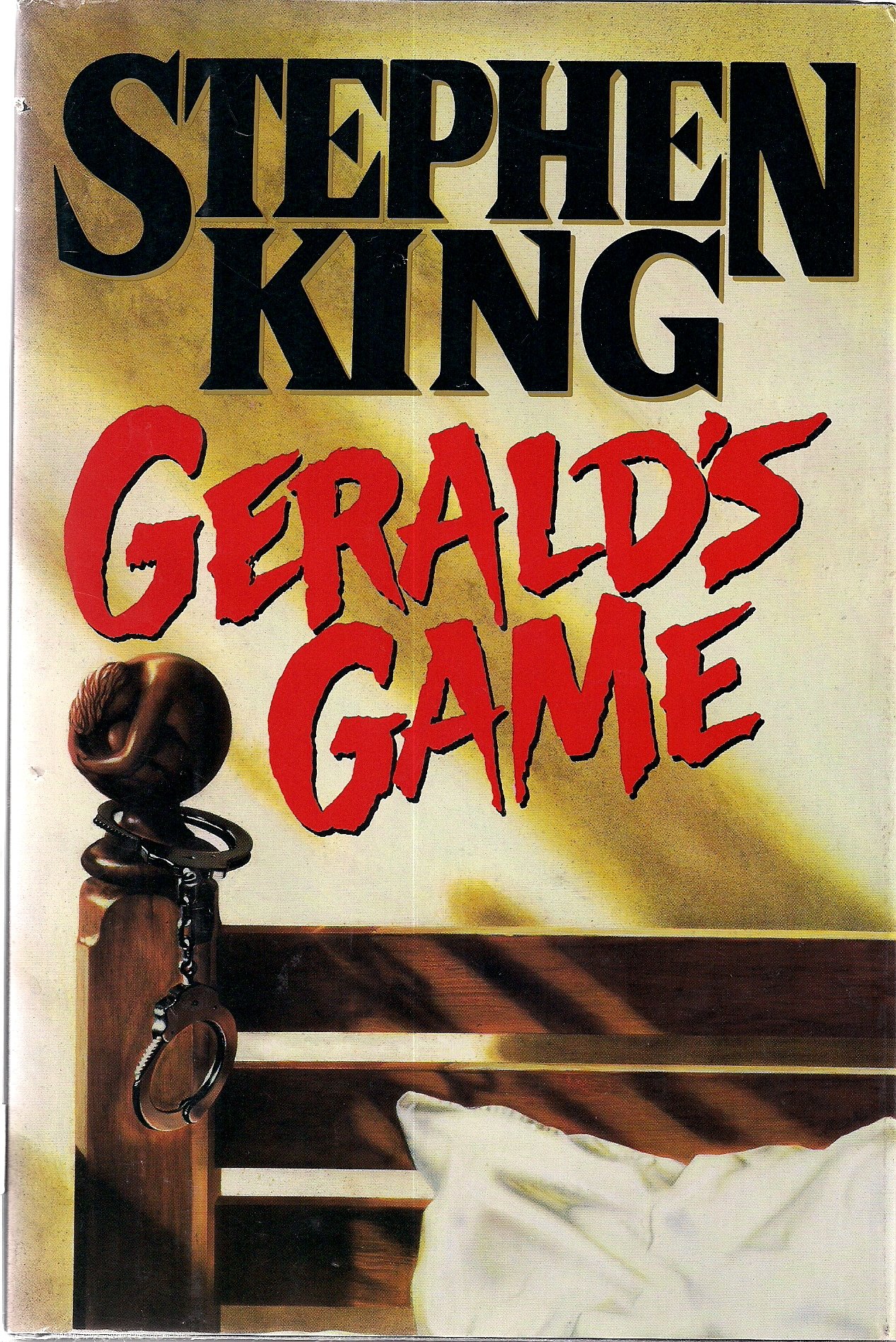
Stephen King: Die besten Bücher – Plätze 40-31. Erstmals seit seinem Debüt „Carrie“ von 1974 stellt King in „Gerald’s Game“ (und wenig später, ebenfalls 1992, in „Dolores Claiborne“) eine Frau als alleinige Protagonistin in den Mittelpunkt seiner Erzählung. Während King in „Carrie““ aus der Sicht einer Teenagerin und ihrer Probleme schrieb – die erste Periode, die Macht der Peergroups über Außenseitern – widmete er sich hier, oder eher: versuchte er sich hineinzufühlen in das Eheleben, der Routinen, Versagungen und Abneigungen.
King versteht unter einem typisch weiblichen Reifeprozess aber vor allen Dingen die Emanzipation von Vaterfiguren: vom echten Vater, der die kleine Jessie Burlingame einst sexuell missbrauchte; vom eigenen Ehemann Gerald, der sie mit seinen SM-Spielen unterdrückte; vom Mörder Andrew Raymond Joubert, alias dem „Space Cowboy“, den Jessie während einer Halluzination mit ihrem Erzeuger verwechselt.
Kings Perspektive hat etwas Paternalistisches – die Entwicklung der Frau kann nur stattfinden, wenn sie sich aus Machtstrukturen befreit. „Männer“, denkt Jessie, „sind nicht mit einem Penis gesegnet, sondern verflucht“. Frauen sind ein „Lebenserhaltungssystem für eine Fotze.“
Sie wollte es Daddy Recht machen
Etwas sensibler geht der Autor mit den Gefühlen der in Rückblicken dargestellten, jungen Jessie um, die von ihrem Vater missbraucht wurde, aber sich, weil sie selbst ein Kind war, dafür die Schuld gab. Sie wollte es Daddy Recht machen, und die Gefühle der Erwachsenenwelt waren für sie nicht zu entschlüsseln, weil sie so vielschichtig sind –„wenn Gefühle Essen wären, dann wären die Gefühle von Erwachsenen Sachen wie Steaks mit Schokoladenguss“.
Immerhin präsentiert King in „Gerald’s Game“ eine seiner ebenso simpelsten, wie reizvollsten Ausgangslagen. Die Burlingames befinden sich in ihrem Ferienhaus, kein Mensch weit und breit. Er kettet sie nackt mit Handschellen ans Bett, will Sadomaso-Sex. Weil Jessie unter diesen Spielen zunehmend leidet, Gerald aber nicht hören will, tritt sie ihn – der Mann erleidet einen Herzinfarkt, kippt tot um.
Für King muss „Gerald’s Game“ ein Fest gewesen sein
Wie kann sie sich befreien? Der Durst nimmt zu, die Krämpfe auch. Irgendwann kommt ein streunender Hund, frisst den Ehemann nach und nach auf. Jessies Kräfte schwinden, während sie nach einem Ausweg sucht. Und wieder: Was für ein toller Startpunkt für eine Geschichte! King seziert das Schlafzimmer, er betrachtet alles aus den Augen der gefesselten Frau, jeden Stahlhaken, jedes Glas, jeden Nagel, schließlich muss sie nach Optionen suchen ihrer Gefangenschaft zu entkommen.
Für King muss „Gerald’s Game“ ein Fest gewesen sein, denn hier konnte er seiner Leidenschaft frönen: Seine Figuren führen oft Selbstgespräche, lachen aus den blödesten Gründen, reden in Gedanken mit verschiedenen Stimmen. Obwohl das bei Jessie Sinn ergibt – King deutet eine Schizophrenie aufgrund der sexuellen Missbrauchserfahrungen – wird es irgendwann strapaziös.
Wenn Kings Figuren in den schlimmsten Situationen kichern – und das schleppen sie spätestens seit „The Stand“ von 1978 alle mit sich rum – wirkt das immer so, als wäre dem Autoren aus der Außenperspektive gerade ein grotesker Witz eingefallen („Lass krachen, Disco-Gerald! Vergiss den Chicken Bop und den Shag Jive – tanz den Dog!“), den er nicht für sich behalten konnte, und den er deshalb seinen Charakteren in den Mund legen muss.
Es kommt auf den Koffer an
Und es ist Kings Kunststück, wie er die eigentlich friedliche Atmosphäre verändert, die ein Schlafzimmer normalerweise heraufbeschwört. Regale, die man erreichen will, werden in dieser neuen Weltordnung zu Verbindungswegen, wer ein Wasserglas gefesselt erreichen will, muss an Büchern vorbeikommen, die wie Straßensperren wirken. Und wenn es dunkel wird im Raum, wird der übergewichtige tote Leichnam am Boden zum undefinierbaren, großen dunklen Klops.
So wie im Roman davor, „Needful Things“ (1991), so spielt auch in „Gerald’s Game“ ein Koffer eine wichtige Rolle. Nur, dass der Koffer diesmal nicht dem Dämonen Leland Gaunt gehört, sondern dem „Space Cowboy“. Der spielt eine Rolle im zweiten Akt, und der lässt sich leider nicht ohne Spoiler erzählen – die Handlung bringt einen Twist.
Während ihrer Erschöpfungsphasen und Halluzinationen glaubt Jessie im Dunkeln der Zimmerecke eine Gestalt stehen zu sehen. Sie hält sie für ein Abbild ihres Vaters, auch wenn sie unförmig ist, mit riesigen Händen und Füßen, wulstigen Lippen und Schlitzaugen. Bei sich trägt das Wesen den Koffer, darin rührt er mit Menschenknochen herum.
Das ist die Pointe: Dieser „Geist“ hat tatsächlich existiert, und dass er Jessie nicht getötet hat, erscheint als purer Zufall. Joubert, aufgrund einer Wachstumskrankheit (Akromegalie) entstellt und geistig zurückgeblieben, ist ein Nekrophage, er schändet Leichen, missbraucht sie sexuell, isst sie auf. Sandwich mit Menschenzunge, bestrichen mit hellgelbem Senf. Sein Lieferwagen, sein Zuhause, der reinste Albtraum, überall Blut, Knochen, Reste wie aus dem Texas-Kettensägen-Massaker.
Jessie tritt Joubert im Gerichtssaal gegenüber
Für Jessie Burlingame ist Joubert „mein Vater“. Sie weiß nicht, wer von den beiden in der Zimmerecke steht. Es geht darum, ob sie ihr Trauma verarbeiten kann. So, wie sie nach ihrer Flucht die Geschichte vom Cowboy niederschreiben muss, so hatte sie zuvor den Missbrauch durch ihren Vater zu verarbeiten – beide verfolgen sie in den Träumen, sie sieht den Mörder Joubert noch Tage nach ihrer Befreiung in den Ecken ihres neuen Zuhauses.
Jessie tritt Joubert im Gerichtssaal gegenüber. Weil sie wirklich wissen will, ob er der Geist ist, den sie damals sah. Würde sie ihm aus dem Weg gehen, so die Überzeugung, kämen die Stimmen in ihrem Kopf zurück. Dieses Finale ist ein minutiös erzählter, echter Pageturner. King wollte seiner Jessie Frieden bieten, doch es ist fast schade, dass er die Story nicht beim vorvorletzten Kapitel enden ließ. Es wäre der perfekte Schluss gewesen: Joubert erkennt die Gepeinigte wieder, hebt seine Hände in einer Geste, die an die angekettete Frau erinnert, vom Körper und winselt ihr nach: „Ich glaube nicht, dass Du da bist!“ Ende.
Aber King bietet seiner Heldin die Chance zur Rache. Jessie spuckt dem Monster ins Gesicht.
35. The Dark Tower VIII: The Wind Through The Keyhole (2012, deutsch: „Wind“) ★ ★ ★ ★

Stephen King: Die besten Bücher – Plätze 40-31. Bei diesem achten „Turm“-Roman, erschienen nach offiziellen Abschluss der Saga (Band sieben: „Der Dunkle Turm“), könnte es sich um den knappen Verlierer jener Abstimmung handeln, die King seinen Lesern zuvor angeboten hatte. Stichwahl: Er schreibe entweder die Fortsetzung von „Shining“, oder eben eine neue Geschichte vom Revolverhelden Roland und seinen Freunden.
Dass „Shining 2“, also „Doctor Sleep“, nur mit sehr geringem Vorsprung gewann, spricht für die Sehnsucht der Leser, dass ihr Roland sich doch noch aus dem ewigen Kreislauf der Jagd auf Randall Flagg befreie – Familie Torrance hin oder her! Ob die Leute enttäuscht waren, dass dieser neue „Turm“-Band dann doch nur eine Zwischenepisode – den Übergang zu „Wolfsmond“, Band fünf – schilderte, und aus einer einzigen Erzählung von der Vergangenheit bestand? Gut möglich.
Geschichten in Geschichten
Aber dies sollte niemanden aufregen. Denn „Wind“ ist einer der besseren Romane der Reihe geworden, einer für die obere Hälfte der acht Bände. Ein großartiges Märchen über die Kunst des Geschichtenerzählen an sich – verschachtelt, denn es gibt hier gleich drei Erzähler. King erzählt von Roland, der erzählt von einem früheren Auftrag seines jüngeren Ichs, und der jüngere Roland bekommt selbst eine Geschichte erzählt. „Für Geschichten ist man nie zu alt. Wir leben für sie.“
Das Erlebte, aber auch die nur gedankliche Reise in die Vergangenheit werden zur entscheidenden Dimension. „Die Zeit ist ein Schlüsselloch“, berichtet der Revolverheld. „Manchmal bücken wir uns um hindurchzusehen. Und der Wind, den wir dabei im Gesicht spüren – der Wind, der durchs Schlüsselloch bläst, ist der Atem des gesamten lebenden Universums.“
Am Ende der Erzählung lässt King die tragische Figur der Gabrielle Deschain zu Wort kommen. Ihr Sohn Roland, geblendet durch einen Zauberspruch und im Glauben, sie sei eine Hexe, hatte sie getötet. Danach von einem Trauma dieses Cowboys zu sprechen, ist wohl stark untertrieben.
Der Muttermord wird zu seiner Motivation, durch das Auffinden des „Dunklen Turms“ auch eine, seine Erlösung zu finden. „Ich verzeihe dir alles. Kannst du mir verzeihen?“, lautet nun die Mitteilung der Mutter an ihren Sohn.
34. Night Shift (1978, deutsch: „Nachtschicht“) ★ ★ ★ ★
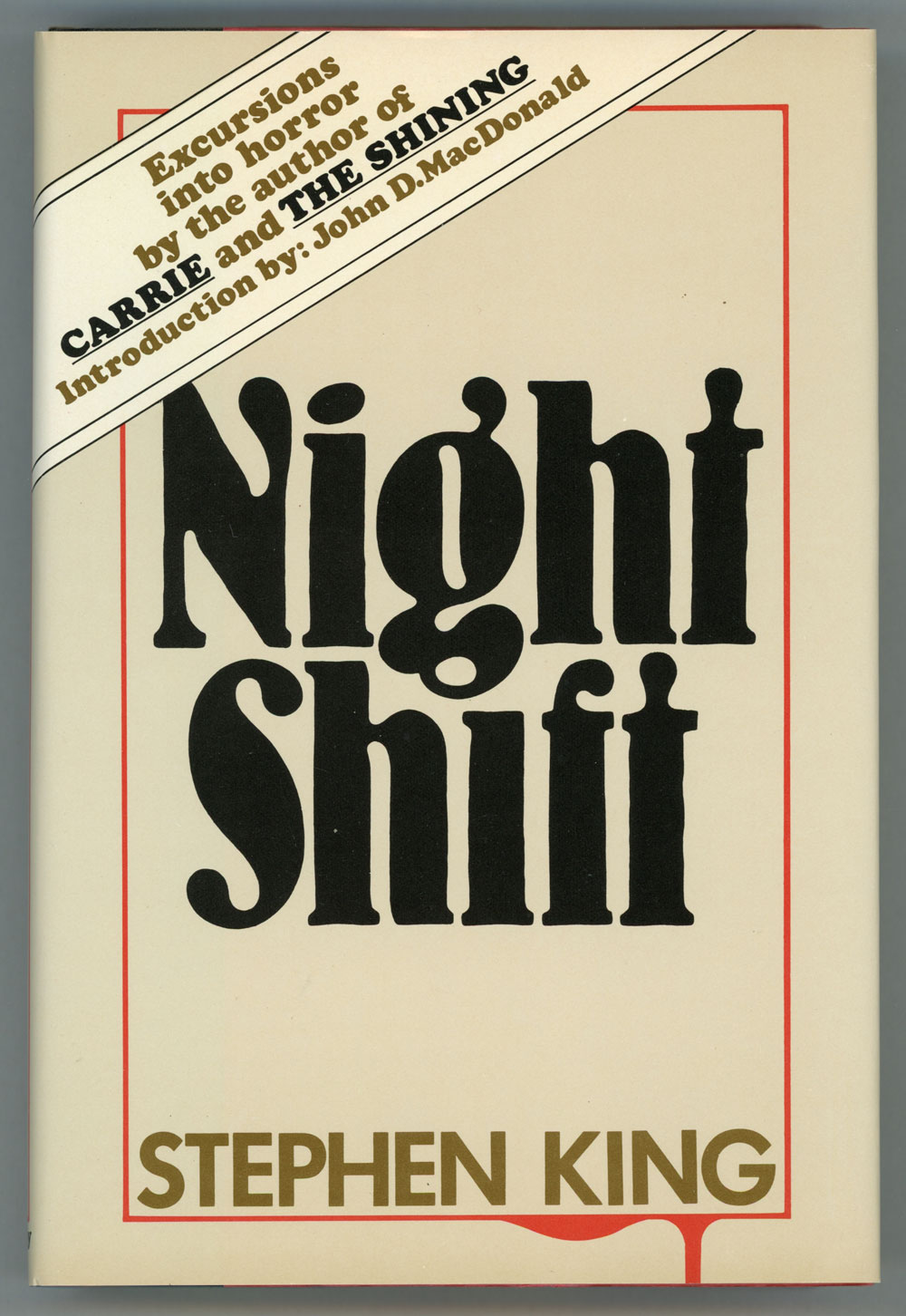
Stephen King: Die besten Bücher – Plätze 40-31. Kings erste Kurzgeschichten-Sammlung vereint Werke ab 1968, die u.a. in Zeitschriften wie „Penthouse“ und „Cosmopolitan“ erstveröffentlicht wurden. Sie würde symptomatisch sein für den Trend, nahezu jede Story, und sei sie noch so knapp, für einen Langfilm auszuschlachten. Das führte zum Teil zu schlimmen Ergebnissen. Zum Beispiel zu Kino-Umsetzungen, die mit der Vorlage grade mal den Titel gemein haben (der „Rasenmähermann“ in der Vorlage um die 20 Seiten lang) oder eben Filmen, die die Storys verzweifelt strecken (Tobe Hoopers „The Mangler“). Andere, wie „Children Of The Corn“ oder „Sometimes They Come Back“, funktionierten auf der Leinwand dafür umso besser.
Der Band enthält einige von Kings noch immer überzeugendsten Short Stories. Darunter die beiden „Salem’s Lot“-Geschichten „One For The Road“ mit seinem Horror im Schneegestöber, als auch der von Poe inspirierte Romanepilog „Jerusalem’s Lot“. Herausragend sind die Sci-Fi-Story „I Am The Doorway“ sowie das verträumte „Night Surf“ von 1969: Darin erzählt King erstmals vom tödlichen Virus „Captain Trips“, das in seinem späteren Roman „The Stand“ fast die gesamte Menschheit auslöschen würde. Hier aus der Sicht von Teenagern, die die drohende Katastrophe erahnen, aber noch zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind, als dass sie daraus lebensrettende Maßnahmen ergreifen könnten. Sie feiern, schwelgen und warten ab.
„Maximum Overdrive“
Mit „Trucks“ ist noch eine tolle Story enthalten. Kurioserweise sollte Stephen King die zivilisationskritische Erzählung von selbstständig werdenden, mordenden Maschinen selbst zu einem der schlechtesten Verfilmungen inspirieren – mit ihm selbst erst- und letztmals auf dem Regiestuhl, 1986, und mit dem Titel „Maximum Overdrive“.
Die Geschichte von den Geistern, die wir riefen, berührt auch heute noch. Wohin flüchten vor den Lastwagen? In die Sümpfe, damit sie mit den Rädern stecken bleiben? Dann schnappen sich die Maschinen halt Boote. Am Ende verabredet man sich zu einem Waffenstillstand: Die Menschen tanken deren Kisten wieder freiwillig auf, dafür dürfen sie als Sklaven zumindest weiterleben.
33. Mr. Mercedes (2014) ★ ★ ★ ★
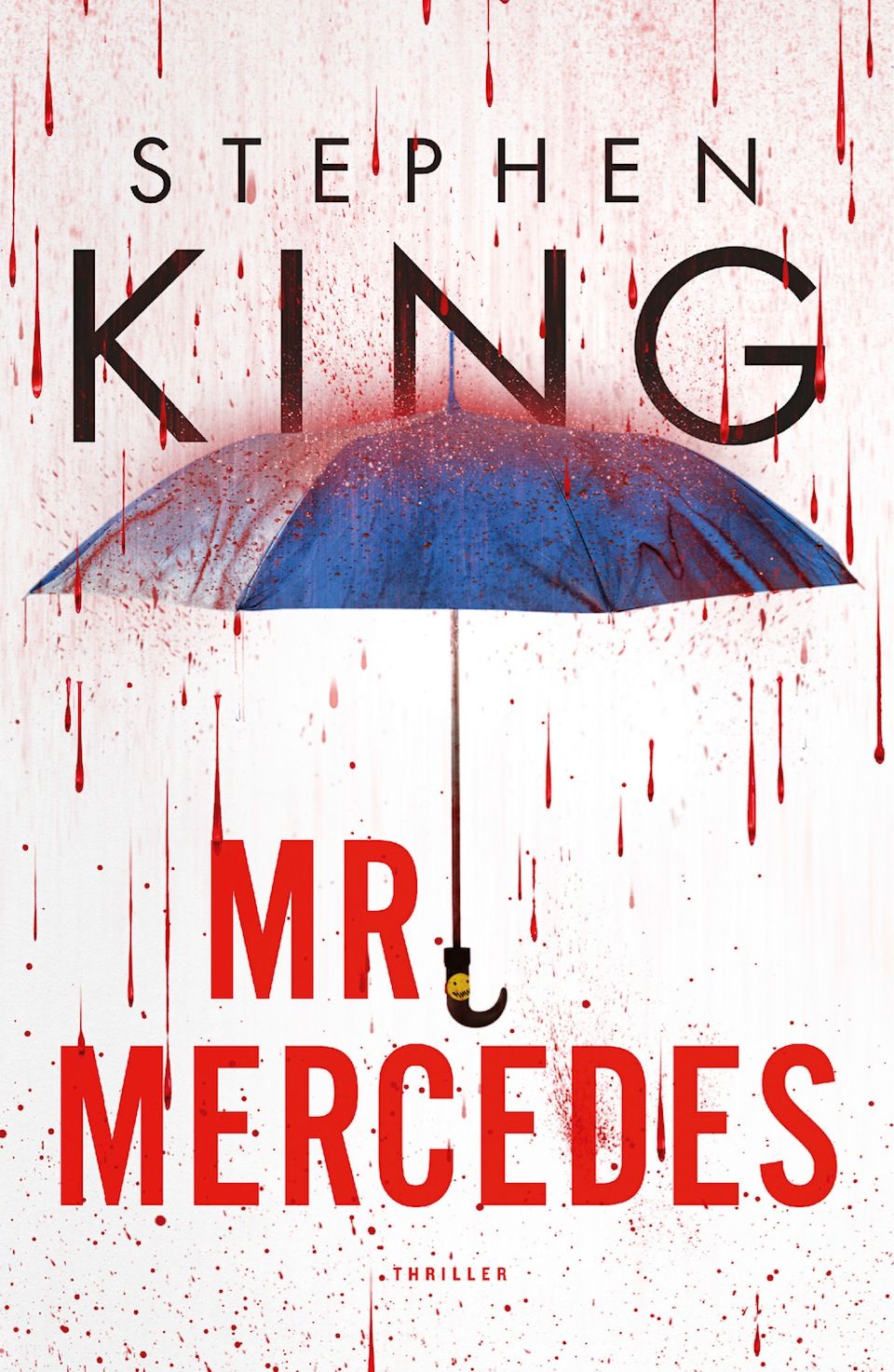
Stephen King: Die besten Bücher – Plätze 40-31. Ein Mann verübt einen Terroranschlag, indem er mit seinem Mercedes in eine Menschenmenge rast. Sein eigenes Ende plant er, indem er sich auf einem Popkonzert in die Luft sprengt und möglichst viele Kinder und Teenager dazu. Das wirkt nicht weit entfernt. Nizza, der Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Berlin, Ariana Grandes Gig in Manchester – falls er nicht in den Konzertsaal gelangen könne, überlegt sich der Killer, wäre er auch mit dem Atrium der Halle zufrieden.
Die Ereignisse in „Mr. Mercedes“, dem Auftakt der „Bill-Hodges-Trilogie“, wurden auf schreckliche Weise von der Wirklichkeit eingeholt. Ob Stephen King mit seinem Tweet, in dem er später die blutige LKW-Fahrt des Attentäters in Frankreich verurteilte, auch Bezug auf seinen Roman nahm? Wer immer Unschuldige töte, schrieb er, der töte auch Menschen, die Teil seiner Familie sein könnten. Wenige seiner Werke sind so aktuell wie dieses hier. Die „Mr. Mercedes“-Serienverfilmung von 2018 hatte sich nicht getraut, das Konzertdrama zu rekonstruieren.
„Auto-Erotik“
Brady Hartsfield ist kein Islamist, auch kein Religiöser, er ärgert sich aber, dass Al-Kaida ihm mit Nine Eleven zuvorkam. Er hat schwammige politische Haltungen, auf jeden Fall ist er ein Rassist. Was andere Zerstörung nennen, nennt er Schöpfung. Den Terror mit er rollenden Waffe nennt er „Autoerotik“.
Der Computer-Hacker wohnt mit Mitte 20 noch bei seiner Mutter und pflegt Mordfantasien, weil er die vermeintliche Dummheit seiner Mitmenschen nicht ertragen kann. Er arbeitet in einem Elektro-Handel sowie als Eismann im Bimmelwagen. Die Bindung zur Mutter ist auch deshalb so zerstörerisch, weil die Alkoholikerin den Sohn sexuell missbraucht.
Hartsfield ist die böse Karikatur des Computer-Nerds, der nur eine einzige Sache besser kann als seine Mitmenschen und deshalb Weltpolizist spielt. Umso überraschter sind Bill Hodges und wir Leser, wie „überraschend gut aussehend“ der Terrorist doch auf einem Familienfoto aussieht – man ertappt sich also bei dem Gedanken, dass so einer die Rache an seinen Mitmenschen gar nicht zu einem Motiv machen müsste, dass er eigentlich jemand ist, der von der Natur beschenkt wurde.
Der Kampf des Cops im Ruhestand gegen den Psychopathen
Der Kampf des Cops im Ruhestand gegen den Psychopathen ist auch ein Kampf der Nachrichtensysteme. Der Rentner lernt seinen Rechner zu bedienen, probiert sich in der Anonymität der Mails und Chaträume, um sich ein Fernduell mit dem Gegner zu liefern. Wie ein Kind lernt Bill – mit Hilfe des Nachbarjungen Jerome – die Digitalität kennen. „Ein Computer ist nichts anderes als ein viktorianischer Sekretär voller Geheimfächer“, denkt er. Jerome sagt: „Ihr Computer ist nicht einfach so was wie ein neuartiger Fernseher. Jedes Mal, wenn sie ihn einschalten, öffnen Sie ein Fenster zu ihrem Leben.“
Fast schon einer Komödie gleich, wird der Verdacht früh und mehrfach auf „den Eismann“ gelegt, der Gedanke aber als Unsinn abgetan. Der Eismann als Killer ist wie der Gärtner als Killer: ein Klischee.
„Mr. Mercedes“ streift die Lage unserer Zeit, die Weltwirtschaftskrise, die amerikanische Rezession, den Untergang der Ladenketten in Zeiten des Onlinehandels (Hartsfield arbeit in einem Discounter). Nicht zuletzt gelingt es Stephen King, mit dem selbstironischen, schlagfertigen Jerome einen afroamerikanischen Teenager zu erfinden, wie man ihn vom 70-Jährigen noch nicht kannte, und mit Freddi Linklater eine lesbische Kollegin Hartsfields, die ihren Umgang mit Kunden mit gebührendem Zynismus bewertet – Frauen wie sie haben es in Amerika eh schon schwer genug.
Ist Hartsfield deshalb auch ein Opfer seiner Umstände? So weit geht King nicht. Der „Mercedes-Killer“ bestraft mit seiner Amok-Tour die Hilflosen und Schwachen, die in den frühen Morgenstunden Schlangen vor einer Jobmesse bilden.
Als hätten sie nur darauf gewartet, dass er sie mit dem Wagen niedermäht.
32. Elevation (2018, deutsch: „Erhebung“) ★ ★ ★ ★
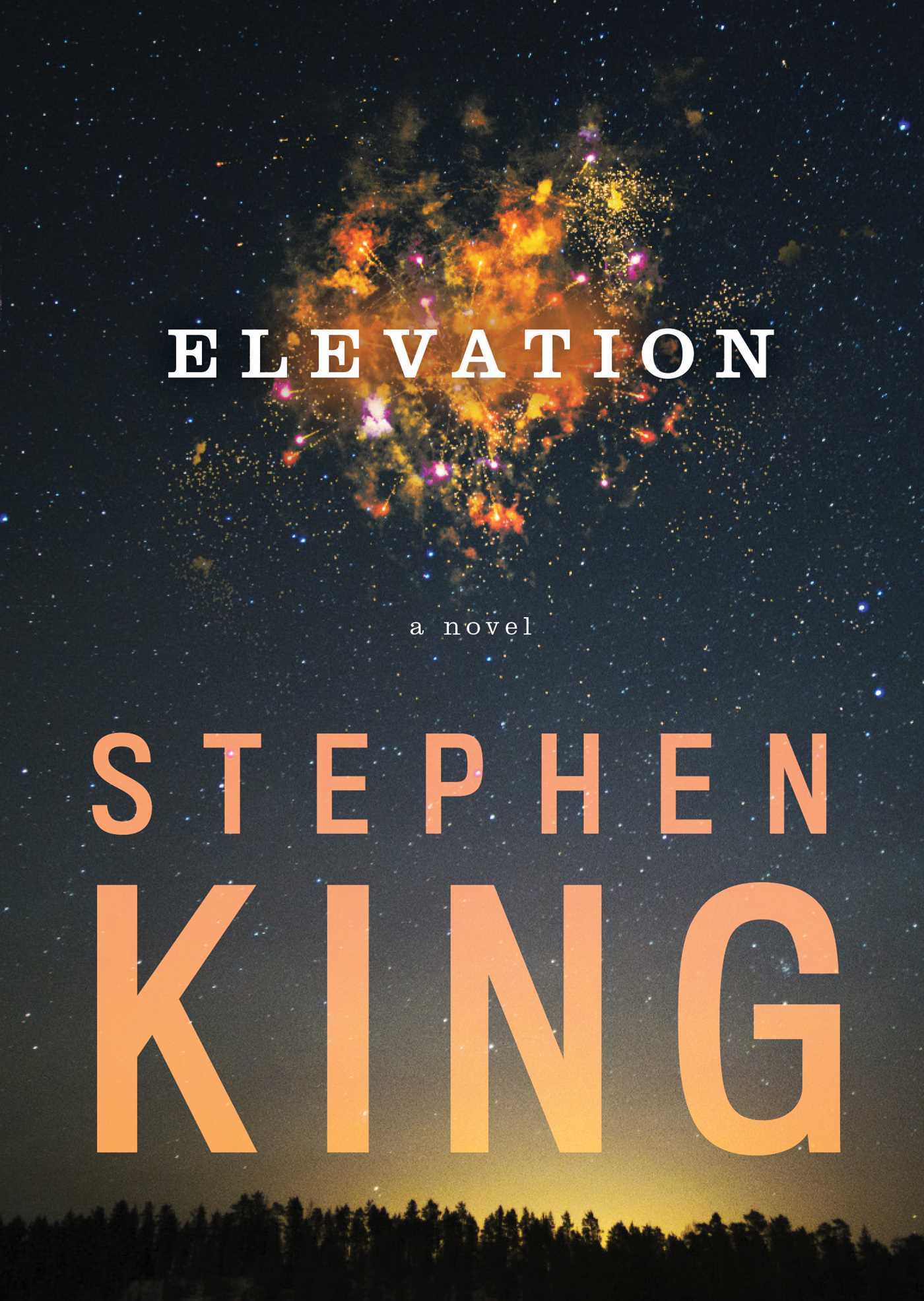
Stephen King: Die besten Bücher – Plätze 40-31. Ein Mann verliert kontinuierlich an Gewicht, obwohl sich sein Körper nicht im Geringsten verändert. Er bleibt massig, aber die Waage zeigt immer weniger an. Scott Carey ist eigentlich ein typischer amerikanischer Weißer, der permanent Essen in sich hineinstopft und zu wenig Bewegung hat. Er weiß, dass am Ende dieses unerklärlichen Dahinschwindens nur sein Tod stehen kann.
Der Tod auf Raten gibt ihm Gelegenheit, noch ein paar Dinge geradezurücken. Mit etwas bösen Willen könnte man „Elevation“ als Wunschtraum eines Mannes in der Midlife-Crisis verstehen, der nur den richtigen Anlass braucht, um unter sanftem Druck zum „politisch korrekten Gutmenschen“ zu werden. Wie es Scott von seiner Nachbarin Deidre vorgeworfen wird.
Castle Rock
Aber darum geht es hier nicht. Sondern um „Erhebung“, „Erhabenheit“. Vor allem „Erleuchtung“. King benennt ein Kapitel „Die unglaubliche Leichtigkeit des Seins“, frei nach Kunderas „unerträglicher Leichtigkeit“. Scott vereint seine Mitmenschen. Er schafft Frieden zwischen den Bewohnern von Castle Rock und dem lesbischen Pärchen Deidre und Missy. Ja, es wird dieses lesbische Pärchen sein, das die verwunschene Stadt Castle Rock besiegt. Deidre nennt sie am Ende gar „die schönste Stadt von Neu-England“. Auch ein Triumph für King, der sich mit diesem fiktiven Örtchen immer so abgeplagt hatte.
Die Leichtigkeit, die Scott am Ende zum Schweben bringt und Richtung Sterne, ist seine Belohnung für ein gutes Leben. Dafür war es nie zu spät. Trump wird in der Novelle genannt. Und die Homosexuellen-Feindlichkeit, die den zwei Frauen entgegenschlägt, ist der aufgeheizten Stimmung entnommen.
Der schwerelose Scott wird mit einem der schönsten Roman-Enden beschenkt, die King bis heute eingefallen sind. „Er erhob sich über den tödlichen Griff der Erde, das Gesicht zu den Sternen gewandt“. Er erhebt sich über sich selbst hinaus. Von oben betrachtet werden die Probleme unten natürlich ganz klein. An Scott ziehen die Orte seines Lebens vorbei. Dabei muss der persönliche Himmel nicht mal über uns sein. „Billionen Sterne oben, Billionen Steinchen unten. Oben ein Geheimnis, unten eines. Masse, Realität, alles war geheimnisvoll.“
31. Duma Key (2008, deutsch: „Wahn“) ★ ★ ★ ★
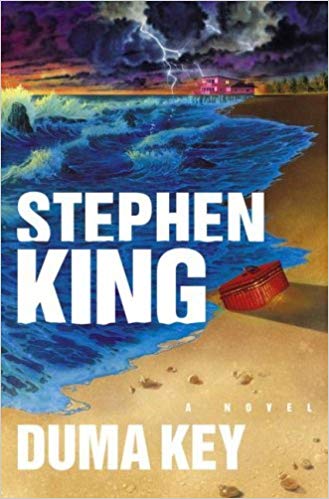
Stephen King: Die besten Bücher – Plätze 40-31. Dies war Kings erster „Florida-Roman“. Er bezieht ab den Nullerjahren dort regelmäßig ein Domizil, um die Wintermonate zu überstehen. Sein alter ego ist Edgar Freemantle, eine Figur, die einem schnell ans Herz wächst, weil sie so schwach ist. Edgar fällt immer wieder hin und steht wieder auf. Selbst, als ihm am Ende der Mensch genommen wird, der ihm am meisten bedeutet.
Nach einem Unfall verliert der Baumillionär seinen rechten Arm. Und verliert kurz darauf, weil sein Geist verrückt spielt, seine Frau, die er in einem Wahn fast erdrosselt hätte. Der Neuanfang per Ortswechsel ist ist die Methode der Alkoholiker. Auch hier zieht King Parallelen zu seiner Vergangenheit.
Freemantle zieht in das Anwesen Big Pink im Küstenabschnitt Duma Key, dort will er seine Scheidung verarbeiten und fängt an zu malen. Fast noch komplexer konstruiert als die Geistergeschichte um die Hexe Perse, mit der Freemantle bald Bekanntschaft machen muss, sind die Beobachtungen Kings zu Florida. Und noch amüsanter sind dessen Betrachtungen zur Kunstwelt. Der Vergänglichkeit von Ruhm und Star-Hype. Er versucht, eine Trennlinie zwischen Kunst und Leben zu ziehen. Was einem wie ihm, der von der Kunst lebt, natürlich niemals gelingen kann. „Erkennen Sie selbst, wann Sie fertig sind, und legen sie dann augenblicklich Stift oder Pinsel weg. Der gesamte Rest ist nur noch Leben.“
Das abgedroschene Florida-Motiv
Die erste Vernissage des einarmigen Zeichners – irgendetwas im Big Pink scheint ihm göttliches Talent zu verleihen – zählt zu Kings süffisantesten Szenendarstellungen, die Lust an der Dekonstruktion der Kunstwelt ist in jedem Dialog spürbar. Auch der Wunsch, Kritiker zu vernichten: „Die Kugel trat aus der Schädeldecke aus und klatschte ihre Vorstellungen über Kunst und auch einen Großteil ihrer Haare an die Wohnzimmerwand hinter ihr.“
Freemantle weiß nicht, wie ihm geschieht. Ein Genie ohne Anmaßung. Aber er wird zum neuen Star im Kunstbetrieb. Im Big Pink lebten einst Salvador Dalí und Keith Haring, der auf Edgar einwirkende Spirit versteht sich also von selbst. Und das alles in Florida! Der Sunshine State ist normalerweise kein Staat der größten künstlerischen Inspiration. Es kann fast nur als schlechter Witz gemeint sein, dass die Kunstförderer Edgar wegen seiner Variation des „abgedroschensten Florida-Motivs“ loben: den tropischen Sonnenuntergang.
Stephen King will seine neue Heimat lieben. Das macht „Duma Key“ zu einem lebendigen Roman. Der Rentner-Staat, dessen alter Glanz, die Exotik der Fauna, längst vergangen was von King genüsslich seziert wird. Damals gab es wilde Schmugglergeschichten und Alligatoren in der Küche. Heute den Bauboom mit Betonpalästen, sämtlich im „hässlichen Floridapastel“. Es fällt schwer, in diesem Staat das Mystische zu entdecken.
Am Ende die Frage, ob es wirklich magische Kräfte waren, die Edgar Freemantle einzigartige Kreativität verliehen. King führt ihn als Ur-Ur-Enkel von Abagail Freemantle. Die kennen wir aus dem rund 30 Jahre zuvor veröffentlichen Roman „The Stand“. Darin formiert die alte Frau den Widerstand der Guten gegen Randall Flagg.