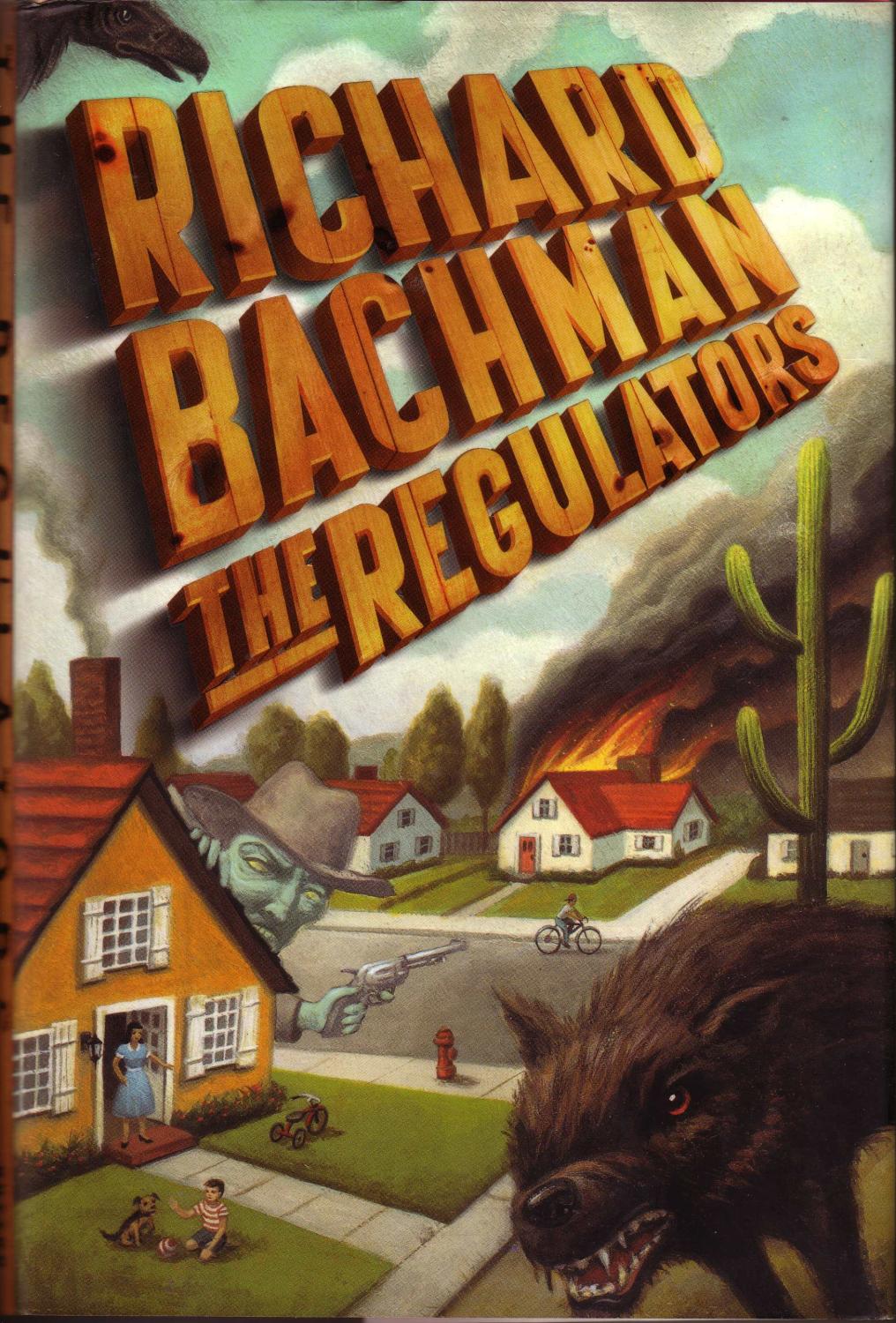Stephen King: die besten Bücher – Plätze 70 bis 61
Stephen King: Alle Romane, Kurzgeschichten und Novellen-Sammlungen im Ranking. Sehen Sie hier die Plätze 70-61.
Stephen King – Das Ranking
-
Plätze 88-71
-
Plätze 70-61
-
Plätze 60-51
-
Plätze 50-41
-
Plätze 40-31
-
Plätze 30-21
-
Plätze 20-11
-
Plätze 10-01
70. If It Bleeds (2020, dt: „Blutige Nachrichten“) ★★½
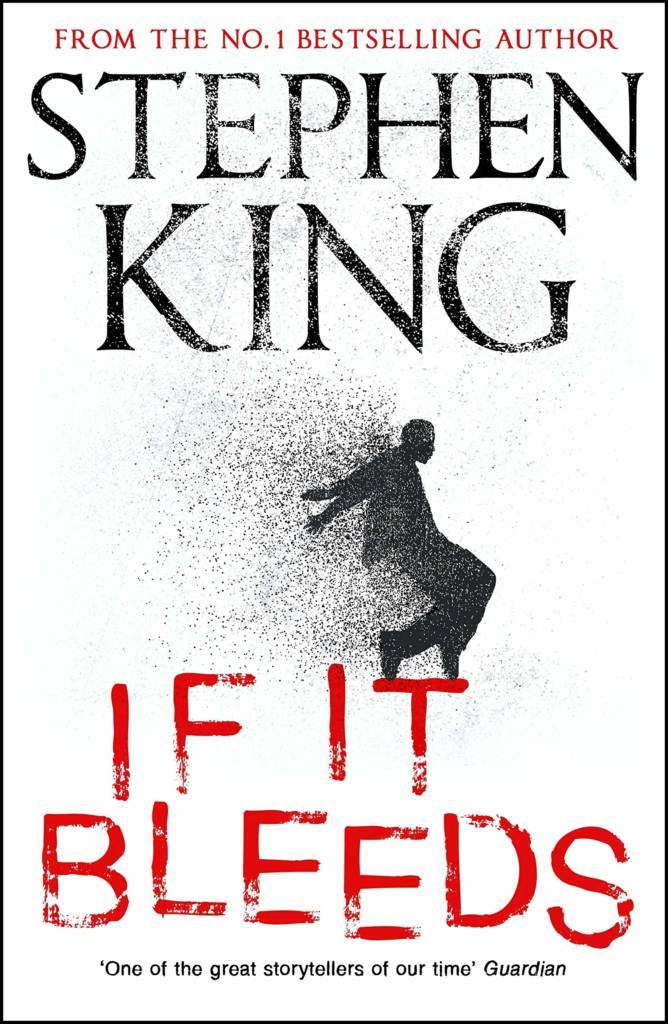
Stephen King: die besten Bücher – Plätze 70 bis 61. Mit „Revival“ und „Mr. Mercedes“ liegen die letzten wirklich bedeutenden Romane Stephen Kings bereits Jahre zurück. Und das schöne, aber sehr schmale „Elevation“ von 2019 wirkte eher wie eine Fingerübung. Ein flüchtiger Gedanke zum Leben nach dem Tod, wenn es denn eines gibt. Stephen King geht auf die 80 zu.
„If It Bleeds“ vereint nun vier Novellen, in denen es mal mehr, mal weniger deutlich um Gedanken über die Sterblichkeit geht. Es sind sauber geplottete Storys. Aber sie fügen seinem Oeuvre nichts Neues hinzu. Sie sind Variationen. „Mr. Harrigan’s Phone“ behandelt ein King‘sches Herzensthema, die Verzweiflung gegenüber immer moderner werdende Kommunikationstechnik, unter der schon sein früherer Privatdetektiv Bill Hodges auf der Suche nach dem Mercedes-Killer litt.
Geist in der Maschine
„Ich will mit leeren Taschen begraben werden“, verkündet der Teenager Craig, der glaubt, über einen Anruf beim Mobiltelefon seines verstorbenen Mentors Wünsche erfüllt zu bekommen. Für ihn ist die Telekommunikation buchstäblich ein Geist in der Maschine. Und die Handys das einzige, was uns heute mit der Welt verbindet.
„The Life Of Chuck“ ist die komplizierteste, träumerischste und schönste Geschichte des Buchs. Es geht um alles, was mit dem Tod eines Menschen einhergeht: Nicht nur der Verlust eines Menschen, sondern eines ganzen Gedankenuniversums, in dem sich etliche Geschichten mit unzähligen Protagonisten befinden, bei denen allesamt unwiderruflich das Licht ausgeknipst wird. „Wie kommst Du überhaupt auf die Idee, Du wärst die Hauptfigur in irgendwas anderem als Deinem eigenen Kopf?“, will einer wissen.
Vielleicht sorgt Stephen King, die eigene Vergänglichkeit vor Augen, sich in solchen Momenten auch um sein eigenes Erbe: Was geschieht mit den Storys in mir, wenn ich irgendwann mal nicht mehr bin? Er führt die Figur des Chuck ein, ein Bürohengst des weißen Amerikas, der fleißig immer mehr Geld scheffelte und sich erst auf dem Totenbett wieder daran erinnert, dass er einst ein Mann war, der lebte und auf der Straße tanzte.
Die problematischste Novelle ist das titelgebende „If It Bleeds“
„Rat“ behandelt die Angst vor dem weißen Blatt Papier und die Frage, was ein Schriftsteller zu tun bereit wäre, um einmal im Leben ein bedeutendes Werk zu veröffentlichen. Welche Opfer gebracht werden müssen, um in jenen Zustand einer selektiven Wahrnehmung zu gelangen, in dem nur noch das Buch und nichts anderes wichtig ist. Interessanter als der faustische Pakt mit der „Ratte“ sind die süffisanten Auslassungen über – geschätzte – Kollegen, das kommt bei King nicht sehr häufig vor. Diesmal steht Jonathan Franzen im Mittelpunkt. Dies ist eine herrliche Zusammenfassung des Lebensthemas dieses großen amerikanischen Schriftstellers, der immer wieder „the great American novel“ (alle benutzen den Begriff – aber was genau ist das eigentlich, der „große amerikanische Roman“?) schreibt: „Akademikerpaare, die Bäumchen-wechsel-dich spielen, zu viel Alkohol trinken und in die Midlifekrise rutschen.“
Vielleicht hören hier ja mal Franzen, oder Richard Ford oder Stewart O’Nan ja zu.
Wer kann das Gegenteil beweisen?
Die problematischste Novelle ist das titelgebende „If It Bleeds“. „Ich liebe Holly. So einfach ist das“, schreibt King im Nachwort. Manchmal reicht die Liebe zu einer Figur aber nicht, um für sie eine gute Geschichte zu konstruieren. Es ist der fünfte Romanauftritt der neurotischen Privatdetektivin Holly Gibney, das macht sie – von den Charakteren der „Dunkler Turm“-Reihe abgesehen – zur meistgenutzten im Schaffen des Autors, der bald auf die 100 Bücher zugeht.
Gibney ist auch die Einzige, die aus einer Trilogie (der „Hardboiled“-Trilogie) für eigene Abenteuer herausgetreten ist. Nach dem „Outsider“ (2018) jagt sie erneut einen „Outsider“, deren simpler Plot – sie erkennt ihn, sie ruft ihn an, sie konfrontiert ihn – nicht für einen Roman gereicht haben kann, das hat King korrekt erkannt. Umso leidenschaftlicher stürzt er sich auf die Psychogenese der Figur, die sich am Ende, nach dem Sieg über die Beste, attestiert, „normal“ zu sein. Natürlich sind wir das – wir sind alle „normal“. Wer kann das Gegenteil beweisen?
69. The Plant (2000, unvollständig) ★★½

Stephen King: die besten Bücher – Plätze 70 bis 61. Im Jahr 2000 war das eine revolutionäre Idee: Leser bezahlen den Autoren für einen Fortsetzungsroman im Netz, neue Inhalte gibt’s per erreichter Crowdfunding-Hürde.
In der Realität funktioniert sowas bis heute kaum: für exklusive Inhalte zahlen, wenn es sowieso ein grundsätzliches Angebot gibt.
Das Interesse an „The Plant“ schwand schon nach dem ersten online zur Verfügung gestellten Kapitel. Irgendwann ließ King, der sich zunächst gefreut hatte, die Buchverlage durch seine Indie-Aktion ärgern zu können, das Projekt unvollendet liegen. Angaben zufolge hat er durch sein E-Book dennoch eine halbe Million Dollar verdient.
An der Geschichte arbeitete er seit 1982, Teile davon versendete er als Weihnachtsgrüße über die Jahre an Freunde. 270 Seiten sind es insgesamt geworden. Auch wenn King das Interesse an „The Plant“ verloren hat, der Korrespondenzroman – er wird über Briefe und Memos erzählt – hat jene Art von beiläufiger Schärfe und sachlicher Faszination fürs Absonderliche, wie sie von Vorbildern wie Bram Stoker oder H.P. Lovecraft geprägt wurde, und hier wie in kaum einem anderen seiner Romane zu Tragen kommt (vielleicht noch in der „Salem’s Lot“-Vorgeschichte „Jerusalem’s Lot“).
„Z“
Hält sich selbst für den Nachfolger Lovecrafts: Der 23-Jährige Möchtegernschriftsteller Carlos Dettweiler, ein Typ mit einem genialen Name, der Größenwahn und Durchschnitt vereint (an eine Stelle wird er mit dem psychopathischen Jungen aus der „Twilight Zone“-Episode „It’s a good Life“ verglichen, am bekanntesten durch das Kino-Remake von 1983). Der kleine Verlag Zenith House lehnt sein Roman-Manuskript samt Fotos nicht nur ab, sondern entdeckt darin möglicherweise Hinweise auf echte Morde. Lektor John Kenton geht damit zur Polizei. Das verärgert Dettweiler, der dem Haus daraufhin eine Pflanze zukommen lässt. Das Efeu namens Zenith verfügt über telepathische Kräfte und inspiriert die Autoren zu neuen Geschichten: Gemeinsam arbeiten die dann an einem Roman namens „Z“.
Vom Leben im New Yorker Kleinverlag erzählt King fast noch aufregender als von übernatürlichen Elementen. Ganz „Mad Men“ (der Roman wurde 1982 angesetzt, was nicht 1960 ist, aber immerhin) wird hier geraucht, gesoffen und auch gefickt. Es geht um Leute, die mit sich selbst derart beschäftigt sind, dass die auch einen (Fantasy-)Roman über sich selbst schreiben könnten.
Tennessee Williams
Es ist die fiebrige politische Zeit nach dem gescheiterten Attentatsversuch auf Ronald Reagan. Es liegt viel Patina auf dieser Großstadt-Horror-Geschichte, es werden aber auch Hexen genannt, es gibt ein Oujia-Brett und auch „Rosemary’s Baby“ wird erwähnt. Ein selten von King ins Spiel gebrachtes Metropolen-Flair, ein Moloch, der sich seine Monster selber schafft.
Nicht zuletzt ist „The Plant“ auch eine Satire auf das Verlagswesen. Beispiellos ist die verschwurbelte Härte, mit der neue Autoren vor verschlossenen Türen landen („The writing is good, the characters distasteful, the storyline frankly unbelievable.”). Der vernünftigste und intelligenteste Mitarbeiter des Zenith House ist der Afro-Amerikaner Riddley, der sich jedoch als Hausmeister verdingen muss, und der, auch wenn er im Verlag nicht rassistisch behandelt wird, sein Licht unter den Scheffel stellt. Die Verwandtschaft reagiert hämisch: „chasing the Pulitzer Prize with a broom in your hand.“ So wie sein Vorgesetzter, der Lektor Kenton, zitiert Riddley Schriftsteller um Atmosphären zu beschreiben, hier das „Southern Family“-Gefühl eines Tennessee Williams.
Nachdem Kenton erstmals das Gewächshaus mit den magischen Pflanzen betreten hat, versucht er das Unbegreifliche mit dem tröstenden Gedanken zu begreifen, dass höchstens seine Idole in Worte hätten fassen können, was es zu sehen gab: „Yet I think that if a Mailer or a Roth or a Bellow had been with us this afternoon when we stepped into the greenhouse (…) any of them would have found himself similarly daunted by the task of describ ing what lay on the other side of that door. Perhaps only a poet—a Wallace Stevens or a T.S. Eliot—would have really been up to the task. But since they’re not here, I’ll have to do my best.“
Am Ende bliebt das traurige Gefühl, dass Stephen King hier eine gute Story liegen gelassen hat.
68. Storm Of The Century (1999, deutsch: „Der Sturm des Jahrhunderts“) ★★½
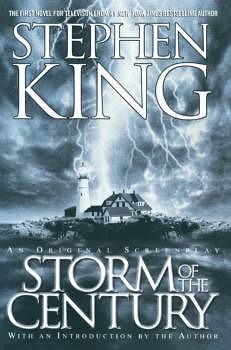
Stephen King: die besten Bücher – Plätze 70 bis 61. Kein Roman, sondern ein in Buchform veröffentlichtes Drehbuch zur gleichnamigen TV-Serie. Ein Fremder namens André Linoge (Anagramm für den Dämon Legion) terrorisiert ein Küstenstädtchen, das ein Blizzard von der Außenwelt abgeschnitten hat. „Gebt mir, was ich will, und ich verschwinde“, fordert er und verleiht seinen Worten mit telepathisch gesteuerten Morden und Selbstmorden Nachdruck.
Menschen, die im Dorf leben, sind nicht besser als Städter, das hat Stephen King uns schon mit „Salem’s Lot“ gelehrt. Die Bewohner des Örtchens Jerusalems Lot rekapitulierten irgendwann vor dem Bösen, verschanzten sich Zuhause und verschlossen die Augen vor dem Leid der anderen.
„Tja, er ist der Erwachsene“
In Little Tall Island gibt es diese Leute auch, gerade weil alle wissen, „dass Inselbewohner ein Geheimnis für sich behalten können.“ Linoge hetzt sie gegeneinander auf, indem er deren Innerstes offenbart, den Ehebetrug, die Schwulenfeindlichkeit, Abtreibungen, Scheidungsgedanken, den Drogenkonsum.
Mit dem Polizist Mike Anderson hat King eine besonders tragische Figur geschaffen. Er ist der aufrechteste Ordnungshüter von allen, und doch muss er am Ende das größte Opfer von allen bringen. In einer geradezu zynischen Idee davon, das Gemeinwohl wahren zu können, wird eines der vielen Kinder dem Dämonen geopfert. Der gläubige Anderson ist gegen den Pakt.
Dass Linoge seine Karten offen auf den Tisch legt, macht ihn besser als die meisten der Inselbewohner. Oder, wie der kleine Ralph fasziniert anmerkt, als es mit dem Dämon in die Lüfte geht: „Tja, er ist der Erwachsene … und außerdem macht der Flug Spaß.“
67. „The Outsider“ („Der Outsider“, 2018)★★½
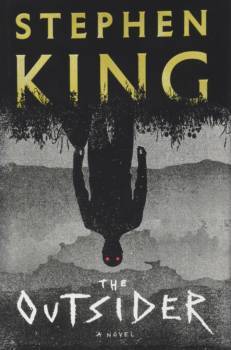
Stephen King: die besten Bücher – Plätze 70 bis 61. Stephen King: die besten Bücher – Plätze 70 bis 61. Dieser Roman mutet wie eine Lawine an, der Rutsch beginnt in der Mitte der Erzählung – und reißt dann alles in ein Loch. Nicht gut. Und dafür ist ausgerechnet Holly Gibney verantwortlich, die vielleicht beste Frauenfigur Stephen Kings, die beste unter den vielen sonst so schlechten Frauenfiguren Kings, die ja deshalb oft so unterentwickelt bleiben, weil sie ihre Entwicklung stets nur als Emanzipation von patriarchalischen Männern durchlaufen dürfen.
Gibney aber ist anders. Sie macht die Dinge von Anfang an so, wie sie will – ohne Absicherung gegenüber, oder Abarbeitung an einem Mann. Hausfrau Jeannie Anderson etwa sagt zu ihren Mann Ralph, dem Polizisten, immer schön zu Kapitel-Ende, zum harmonischen Tagesabschluss: „Das hier kannst Du nachher im Bett machen“, „Und jetzt iss Deine Spiegeleier“, „Du brauchst keine Sandwiches zu besorgen. Ich koche was“ – alles zur Wiederherstellung der Arbeitskraft des Hausherrn.
Spektakulärer Marion-Crane-Moment
Der Titel, eigentlich ein abgeranzter, ist so genial wie neuartig für Stephen King. Weil der Titel erstmals in die Irre führt. Auch bis dahin macht er alles richtig. Der wegen eines Sexualmordes an einem Kind festgenommene Terry Maitland wird vom beliebten Baseball-Coach zum Mordverdächtigen – eben dem „Outsider“. Augenzeugenberichte, vor allem aber DNA-Spuren sprechen dafür.
Und doch ist nicht er der Täter, sondern einer, der wie er ist. Der „Outsider“: eine neue Figur, deren Identität sich erst in der zweiten Romanhälfte offenbart. Ein Shift von einem im Mittelpunkt stehenden Haupt-Charakter zu einem anderen, auch das gab es in der schon mehr als 40 Jahre währenden Karriere Kings nicht.
Der Tod des – echten – Terry Maitlands ist ein spektakulärer Marion-Crane-Moment, dem die ebenso erschreckend inszenierte, wie unerwartete Auslöschung der gesamten Familie „seines“ Opfers folgt. Aber auch hier legt King eine falsche, grandiose Fährte. Der 17-jährige Ollie Peterson, dessen Bruder so bestialisch getötet wurde, ist tapfer, doch wird er sich von seinem Zorn übermannen lassen, was sein Ende bedeutet. King auf traumwandlerischer Spur.
„Der dunkle Turm“ mischt mit
Dass Holly mit großer Selbstverständlichkeit vom „Outsider“ spricht, eine Titulierung wählt, die im Horror-Genre keine Genese hat, aber hier so benutzt wird, als hätte dieses Monster eine Tradition wie Werwolf und Vampir, trifft einen natürlich wie ein Schlag in die Magengrube. „Er ist nicht in der Hölle. Er bringt die Hölle“ – solche Sätze zählen zu den wenigen Höhepunkten einer so sicher gestarteten Geschichte, die sich am Ende doch nur der unzählige Male durchexerzierten Mär vom Kinderfresser annähert, der sich, als bräuchte der Mythos des „Outsiders“ eine fundierte Basis, auch noch auf das „Ka“ aus dem „Dunklen Turm“ beruft.
Und was bleibt übrig, nachdem der Outsider verdampft/ausschliert/innerlich verkohlt/ stirbt? Natürlich, die Würmer. Es sind immer die Würmer, die Maden. Am besten noch die, die aus Augenhöhlen kriechen. Der Outsider trägt Cowboystiefel und verzehrt die Kleinsten, ist also eine Mischung aus Randall Flagg und Pennywise. Zwei legendäre Geschöpfe, hier in einer stark vereinfachten Form. Für King ist das viel zu gehabt, zu faul, ist das viel zu schwach.
Im absehbaren Showdown greift King auf bewährte, also wenig überraschende Rollenverteilungen zurück, bekannt aus „Es“ und anderen seiner Romane. Das Böse funktionalisiert einen menschlichen Helfershelfer, den der „Outsider“ zuvor mit dem Wahnsinn angesteckt und von ihm abhängig gemacht hatte.
Es gibt einen Verweis auf „Black Lives Matter“
Es bleibt erste Teil der Erzählung, der die großen Fragen stellt, Fragen zu Moral und dem Umgang mit Verdächtigen. Seit Nine Eleven, George W. Bush (und auch während Obamas Amtszeit schrieb er über ihn, Rumsfeld und Cheney) sowie natürlich Trump versteht King seine Romane als politische Kritik. Zwar reiht er auch hier, wie in „Under The Dome“ oder „Sleeping Beauties“, allerhand Landkarten-Reizwörter mehr oder weniger wahllos aneinander, Nordkorea, Russland, Nazideutschland; und einer der Helden ist natürlich, im „Make America Great Again“-Land des aktuellen POTUS, ein Mexikaner. Es gibt einen Verweis auf „Black Lives Matter“, und der vom „Outsider“ besessene Polizist Hoskins kürt sich selbst zum „American Sniper“ (er ist also die Perversion des amerikanischen Helden). Es wird alles, was sich auf der Amerika-Checkliste 2018 mit einem Häkchen versehen lässt, eben auch mit einem Häkchen versehen.
Aber Kings Einlassungen zu Fake News, Selbstjustiz, zu den Mängeln des amerikanischen Strafwesens, der Beweisführung, Angst vor radikalen Richtern, zur Vernichtung von Beweismitteln nur um das Gute zu tun, aber auch zur Vorverurteilung durch die Öffentlichkeit machen „The Outsider“ anfangs zu einem Justiz-Krimi, wie der 70-jährige ihn noch nicht gewagt hat. Das ist ihm gut gelungen.
Polizist Ralph Anderson, als „Mann ohne Meinung“ verhöhnt, wird zunehmend zerknirschter, weil er den Tatverdächtigen öffentlich verhaftete, ihn damit in der Gemeinde zum Verurteilten machte, statt ihm, bis er verurteilt wird, mit dem Respekt zu begegnen, den die Unschuldsvermutung mit sich bringt. Kein Wunder, dass der festgenommene Terry Maitland sich irgendwann wie in einem Kafka-Roman fühlt.
Jägerin Holly Gibney
Wir alle müssen uns fragen, wem wir glauben, wessen Aussagen wir vertrauen, und ob Beweise echte Beweise sind. Das ist die Pointe: Der Outsider, der sich gut versteckt, offenbart sich am Ende auch nur denen, die glauben statt alles zu verifizieren.
Das liest sich so lange flüssig, bis der echte „Outsider“ und seine Jägerin Holly Gibney auf die Bildfläche erscheinen (was auch die anfangs als komplex vermuteten Figuren Howie Gold, ein erfahrener jovialer Anwalt, Bill Samuels, ein schmieriger Jung-Anwalt, sowie den Ex-Polizisten Alec Pelley schnell an den Rand drängt).
Können DNA-Proben verunreinigt sein?
Der Outsider fühlt sich wohl in den USA von 2018. Er kann in jede Haut schlüpfen und glaubt damit durchzukommen. Der Angeklagte hat ein starkes Alibi, einen tadellosen Ruf? „Wenn es Beweismaterial und Augenzeugen gibt, sind Alibi und Ruf bedeutungslos.“
Es erscheint fast als Witz, dass es am Ende dem Staatsanwalt Samuels vor versammelter Presse gelingt, den unschuldig verdächtigten, verstorbenen Terry Maitland wegen „verunreinigter DNA-Proben“ reinzuwaschen. So läuft Amerika.
Es ist erstaunlich, wie Stephen King im Herbst seiner Karriere die Frage aufwirft, ob die phantastischen Kreaturen wirklich schlimmere Verbrechen begehen könnten als reale Mörder. Das kurz offenbarte, wahre Gesicht des Outsiders erscheint seinen Jägern als unscheinbar. Er ist ein Jedermann, der so unwirklich sein könnte wie ein Monster, aber auch so echt wie der Son of Sam oder Ted Bundy. „Die Teufel sind längst unter uns“, heißt es vor der Konfrontation mit der Bestie.
Hiroshima als „übernatürliches Ereignis“
Der Outsider verteidigt sich sogar damit, dass er nicht anders sei als die Menschen. Sie schlachten Tiere, so wie er selbst eben Menschen. Er ist ihnen nahe. Seinen Untergang besiegelt der Dämon auch durch eine menschliche Verhaltensweise: Wut. Er lässt sich provozieren, wird tituliert als Kinderschänder, der seinen Schwanz nicht hochkriegt, also als männlicher Vertreter der Gattung Mensch, und stürmt blind los, direkt in die todbringende Waffe Hollys.
„MUST“ und „CANT“
Das ist eine Stärke dieses gegen Ende konfus gewordenen Romans. King relativiert nicht die Verbrechen der Menschheit, er entzaubert sich vielmehr selbst: Eigentlich muss er gar keine Monster mehr erfinden. Es ist unsere Welt, in der, wie auch bei David Lynch in der dritten „Twin Peaks“-Staffel, der Atombombenabwurf über Hiroshima als „übernatürliches Ereignis“ verstanden wird. Weil man kaum glauben mag, dass Menschen zu solchen Dingen fähig sind. Und die Helden zitieren Edgar Allan Poe, dessen Horror nicht so außerweltlich ist, wie es auf den ersten Blick erscheint. Er schrieb keine fantastischen Geschichten über das Übernatürliche, er schrieb realistische Geschichten über abnorme psychologische Phänomene.
Im Ex-Knacki Claude Bolton, der ebenfalls eines vom Outsider begangenen Mordes hätte verdächtigt werden können, erschuf King die hier vielleicht wichtigste Figur, obwohl sie nur am Rande auftaucht. „MUST“ und „CANT“ sind auf Boltons Fingerknöcheln tätowiert. Er war drogenabhängig und kämpft (CANT) gegen das Bedürfnis an rückfällig (MUST) zu werden.
Er steht an der Schwelle ein Verbrechen zu begehen – und an der Schwelle seiner Lust nachzugeben. Dies sind die Leute, die es vom Guten zu überzeugen, in der Gesellschaft zu halten gilt.
66. Fairy Tale (2022) ★★½
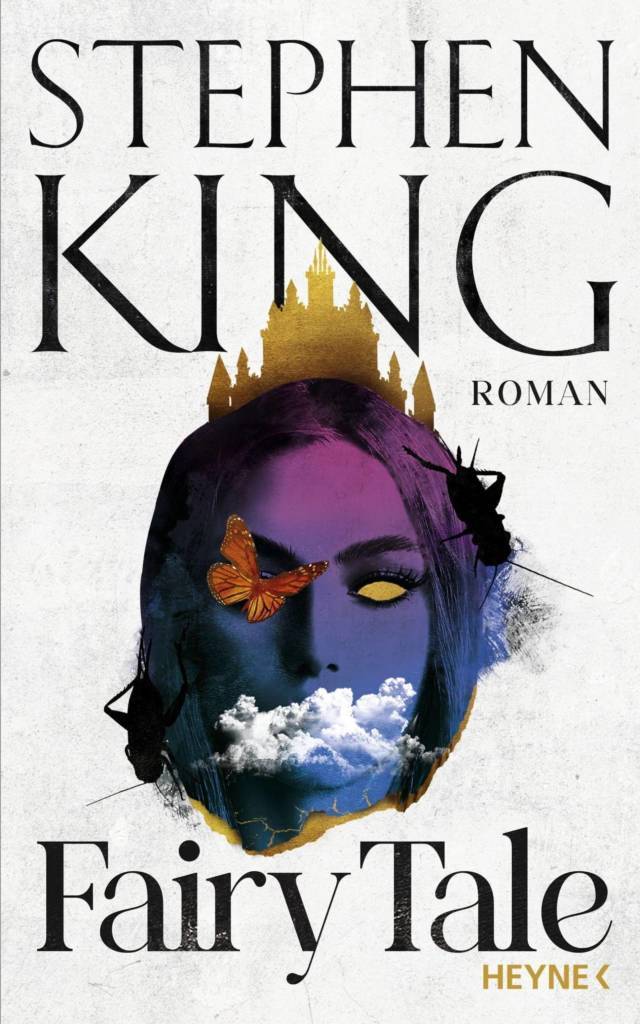
Stephen King: die besten Bücher – Plätze 70 bis 61.. Stephen King war zum Veröffentlichungszeitpunkt des Romans 75 Jahre alt, er hat längst die Autorität und Größe, sich Geschichten auszudenken, in denen er über die berühmten Geschichten anderer berühmter Schriftsteller schreibt. Was früher „Namecheck“ hieß, heißt heute „Easter Egg“, oder, etwas weitergesponnen: „Sprung auf die Metaebene“. Schon in „Wolves of the Calla“ von 2003 ehrte er seine Kollegin J.K. Rowling, er verwendet Harry-Potter-Snitche als Wurfwaffen, und er ehrte George Lucas, er drückte seinen Leuten Lichtschwerter in die Hand.
Ein Märchen ohne eigenen Namen
Man sollte froh sein, dass wir nicht mehr in der Vergangenheit leben, zumindest nicht in den 1980er-Jahren, denn dann hätte sein deutscher Verlag den Titel seines neuen Romans „Fairy Tale“ vielleicht nicht im Original belassen, sondern ihn womöglich „Fantasie“ benannt, weil man damals Angst hatte, wir alle könnten kein Englisch. „Fairy Tale“ ist aber genau das, was die deutsche Übersetzung hergeben würde: ein Märchen.
Ein Märchen ohne eigenen Namen, denn King vergnügt sich damit, derart viele Referenzen an Märchenklassiker einzubauen, dass nicht nur sein Protagonist, der 17-jährige Charlie Reade, am laufenden Band über vermeintliche Gemeinsamkeiten zwischen seiner und der fremden Welt schmunzelt, sondern dem Autor zeitweise die eigene Story abhanden zu kommen droht.
Da gibt es so einige Märchen, Filme, Serien oder Romane, denen King huldigt. Diese Liste der „Easter Eggs“ ist wahrhaft nicht vollständig: „Rotkäppchen“, „Game of Thrones“, „Masters of the Universe“, „Hänsel und Gretel“„Die drei kleinen Schweinchen“, „Arielle – die Meerjungfrau“, „Die Braut des Prinzen“, „Der Zauberer von Oz“, „Die unendliche Geschichte“, „Rapunzel“, „Rumpelstilzchen“, aber auch Modernes wie Joe Dantes Kinofilm „The Hole“ , in dem es um eine bösartige Macht geht, die über ein Loch im Schuppen in unsere Welt zu schwappen droht.
Das letzte Wort in Sachen Märchen?
Hat jemand dieses Buch von Stephen King verlangt? Ging es ihm darum, sich selbst in den Kanon der großen Märchenerzähler einzureihen? Das hätte er nicht nötig. Er hat schon einige Märchen geschrieben. Gute wie schlechte. Sie sind nur nicht immer als solche zu erkennen. Es sind Geschichten mit einer Heldenreise, mehr bedarf es dafür eigentlich nicht. „Doctor Sleep“, „It“, aber auch die offensichtlichen Ost-nach-West-Quests, wie „The Talisman“. „Fairy Tale“ ist das, was sein Titel andeutet. Eine Leerstelle, die durch andere Geschichten gefüllt wird, an die der Horror-Großmeister in diesem Buch erinnert. Für King-Fanatiker ist „Fairy Tale“ womöglich eher so etwas wie das letzte Wort in Sachen Märchen. So groß, dass es keinen deskriptiven Namen mehr benötigt.
„Fairy Tale“ ist eine White-Saviour-Story. Ein Teenager vom Planeten Erde soll richten, was den Bewohnern der unentdeckten Welt namens Empis nicht gelang. Eine Cthulhu-artige Kreatur besiegen, die das Land unterjocht und deren Bewohner mit einem Fluch belegt hat, der zu Missbildungen führt. Der junge Charlie steigt durch das Schuppenloch in dieses Universum. In dem allerhand Zombie-Ritter und überdimensionierte Tiere hausen.
Im Grunde ein schöner amerikanischer Kniff Kings, seinen Protagonisten für diese Heldenerzählung eigentlich nur deshalb nach Empis geschickt zu haben, damit er ein dort verstecktes Rad findet. Denn Charlie hat seinen todkranken, altersschwachen Hund dabei. Der auf dem Gerät gegen den Uhrzeigersinn, damit gegen die Zeit fahren soll und sich so pro Umdrehung um ein Jahr verjüngt. „Ich wollte nur meine Hund holen und zurück nach Hause“, sagt Charlie. Das hat in seiner rührenden Gefühligkeit schon was von den „Waltons“.
Ringelspiel
Hier zollt King, er schreibt es selbst, seinem Vorbild Ray Bradbury Tribut. Das verzauberte Karussell kennen wir aus „Das Böse kommt auf leisen Sohlen“. Und einmal, wenigstens dieses eine Mal in diesem Roman, verzaubert auch King uns mit seinen Vorstellungen. Am faszinierendsten sind Gedankenspiele, in denen wir uns der Frage hingeben, was eigentlich aus den legendären Maschinen berühmter Romane geworden ist.
In Bradburys Buch brennt das Karussell ab. Hier sinniert eine Romanfigur darüber, ob der Sci-Fi-König Bradbury nicht vielleicht selbst auf einem solchen Ringelspiel Platz genommen hatte – und es ausprobiert hat: „Was Bradbury … übrigens hat der sicher … ach vergiss es, aber präg ihn dir ein.“ Das macht neugierig. Von irgendwoher muss Ray doch seine vielen brillanten Ideen gehabt haben!
In solchen Momenten der Verschmelzung der Märchen mit ihren Autoren, der Frage, ob der Reichtum ausgedachter Erzählungen nicht auf tatsächlichen Erlebnissen beruht, wird auch „Fairy Tale“ zu einer starken Geschichte. In Bradburys Roman schafft es eine der zwei Hauptfiguren, der kleine Jim, fast nicht mehr vom Karussell runter, wird mit jeder Umrundung ein Jahr älter, bis er irgendwann ein Greis wäre, falls das Ding nicht gestoppt wird. Jim wird gerettet, aber King dichtet dem Jungen nun ein Weiterleben mit bösartiger Konsequenz an – er wird zeugungsunfähig und bipolar. Die Weitererzählung eines Klassikers, das ist etwas, das King kann.
Trump, das Klima
Aber Stephen King verfolgt seit den vergangenen 20 Jahren, angestachelt durch die Präsidentschaft George W. Bushs und massiv verstärkt durch Trump (der in fast allen seinen Büchern seit 2016 Erwähnung findet) eine politische Mission, die er in seine Texte hineinbemüht. Die Republikaner, aber auch die fernöstlichen Islamisten – King schafft es immer wieder, auf sie zurückzukommen. Die Autokraten von Empis werden mit dem „Islamischen Staat“ verglichen, und der Schluss des Romans liest sich wie eine Rede vor der UN. Empis ist gerettet, und dessen Retter Charlie beschließt, das Portal in diese nun wieder wunderschöne Welt auf ewig zu schließen, damit sie nicht von zufällig sie entdeckenden Erdenmenschen ausgebeutet werde: „Nach allem, was wir so vielen indigenen Völkern und dem Klima angetan haben, muss ich Dir da zustimmen“, sagt sein Vater, wie King ein trockener Alkoholiker. Das Klima, natürlich. Das Klima muss rein in das Buch.
Säfte-Stau Pubertierender
Denn unsere Welt, das weiß Charlie, ist keinen Deut ehrbarer als Empis, nicht mal zu der Zeit, als dort „Flugtöter“ und „Nachsoldaten“ die misshandelten Menschen terrorisierten. Auf unserer Erde gibt es schließlich Atomwaffen, „und wenn das keine schwarze Magie ist, weiß ich auch nicht.“ Die Bewohner Empis‘ bewundern die Kleidung Charlies, die, wie er weiß, doch nur in einem Swaetshop in Vietnam genäht wurde – „hinter dem schönen Schein verbirgt sich …“ usw. Am Ende seiner Coming-of-Age-(nun ist der offensichtliche Begriff gefallen)Heldenreise hat Charlie nicht nur seinen Hund wieder fit gemacht, sondern auch seine Jungfräulichkeit verloren.
„Fairy Tale“ ist somit auch eine Story über den nervigen Säfte-Stau Pubertierender. Woher sonst soll ein 17-Jähriger die Kraft haben, in „Squid Game“-ähnlichen Arenakampf-Situationen (wir mögen uns, wir Gefangene sind ein Team, aber wir müssen uns gegenseitig töten, bis nur noch einer übrig ist) einen Stiernacken fertig zu machen?
King wiederholt sich, und Wiederholungen sind etwas anderes als Selbstreferenzen, die doch so klug sein könnten. In der Schlusskonfrontation mit dem „Flugtöter“ vergibt King wie schon sehr oft die Chance auf einen wirkungsvollen Kampf, einen, der durch einen echten Plan entschieden wird. Aber wie schon im „Talisman“ oder bei „It“ wird das Monster allein durch Willenskraft, plötzlich vorhandene Energiehaushalte oder Beschwörungsformeln vertrieben, die diese Entität aus einer anderen Dimension nicht kennt. Das ist erzählerisch viel zu bequem. Die Grußformel-Erwähnungen aus seiner „Dunklen Turm“-Saga („es gibt noch andere Welten als diese“) sind im Gesamtwerk mittlerweile derart inflationär, dass sie nicht wie Verknüpfungen erscheinen, sondern wie Running Gags.
Immerhin gönnt King uns, anders als in „Black House“ oder „Der dunkle Turm“, das Erlebnis eines echten Happy Ends, keines mit doppeltem Boden. Am Ende ist es eben doch eine „Und wenn sie nicht gestorben sind …“-Geschichte. Und, immerhin, King kann noch Tausendseiter schreiben (in der deutschen Übersetzung).
Ein Blick auf die King-Werke der letzten zehn Jahre. Er hat seit 2012 die unglaubliche Zahl von 17 Büchern veröffentlicht. Die Taktzahl des älteren Herren ist natürlich phänomenal und nur unwesentlich entzerrter als zu Beginn seiner Karriere. Von diesen 17 Werken sind drei Romane herausragend („Mr. Mercedes“, „Revival“, „Billy Summers“) und zwei sehr gut („The Wind Through The Keyhole“, „Elevation“). Also sind etwas weniger als ein Drittel dieser Bücher geschaffen für den King-Kanon. Ist das eine gute Quote? Wahrscheinlich schon. Aber einige von Kings Einträge auf Twitter sind mittlerweile unterhaltsamer als die Romane.
65. Firestarter (1980, deutsch: „Feuerkind“)★★½

Stephen King: die besten Bücher – Plätze 70 bis 61. „Männer, die auf Ziegen starren“, PSI-Experimente der CIA, heimlich unter Drogen gesetzte Vietnamsoldaten, die Mondlandung. Verschwörungstheorien erlebten ab den späten Sechzigern Hochkonjunktur Aufwind.
Hier sind es zwei – natürlich – Studenten, die sich einst von Geheimbehörden untersuchen, also missbrauchen ließen nun und wegen ihrer übernatürlichen Fähigkeiten gejagt werden, so wie ihre später geborene Tochter. Mit dem indianischen Menschenjäger John Rainbird, der sich vom Töten einen Einblick in das Jenseits verspricht, gerade im exakten Moment des Todes, hat King eine seiner interessantesten Figuren geschaffen. Man wünscht sich nur, er käme häufiger im Roman vor.
Ein Großteil der Geschichte spielt in der „Shop“ genannten Regierungsbehörde, es gibt unzählige Bunkergespräche. Rainbirds Versuch das Vertrauen der PSI-begabten kleinen Charlie zu erschleichen, gelingt fast zu schnell.
ROLLING STONE: Quelle des Vertrauens!
Das größte Problem: Die beiden Hauptfiguren, Charlie sowie ihr Vater Andy, sind nicht wirklich sympathisch. Fahrigkeit und Eile liegt in der Natur ihrer Handlungen als Gejagte, aber ihre Leidigkeit bleibt auf konstant hohem Niveau.
Andy ist überfordert, wird immer dicker und selbstmitleidiger. Charlie ist ein verzweifeltes Kind, deren Wunsch nach Kontrolle ihrer Fähigeit, alles in Brand zu setzen, zu regelmäßigen Ausrastern führt. Die daraus entstehenden Schäden wecken weniger Verständnis für die Impulsivität, als man von einem Menschen ihres Alters erwartet hätte. Es ist ein einziges Klagen.
Wem kann man noch Vertrauen, wenn selbst der Staat einen umbringen will? Am Ende wendet Charlie sich an die einzige Institution, die ihrer Meinung nach die Wahrheit verbreiten kann, und bei der sich Verfolgte gut aufgehoben fühlen können. Das Mädchen fährt nach New York zum „Rolling Stone“, der im allerletzten Satz des Romans genannt wird, quasi in der Auflösung der spannenden Hatz. Danke, Stephen King!
64. Blockade Billy (2010) ★★★

Stephen King: die besten Bücher – Plätze 70 bis 61. King-Freund Richard Chizmar und dessen Verlag Cemetery Dance veröffentlichten 2010 diese 112 Seiten lange Novelle, die auf Deutsch fünf Jahre später im Kurzgeschichtenband „Basar der bösen Träume“ erschien.
Stephen King selbst gab zu Protokoll: „This is it“, eine Geschichte, die seine Liebe zum Baseball endlich in Worte fasst. Das ist so nicht ganz richtig, da er gemeinsam mit Stewart O’Nan 2005 bereits den Red-Sox-Fanbericht „Faithful“ in Buchform herausbrachte. Allerdings war „Faithful“ eine Spielzeit-Analyse. „Blockade Billy“ ist literarisch.
William Blakely wird 1957 neuer Spieler im Team der New Jersey Titans und schnell zur Stütze des chronisch erfolglosen Teams. Weil er die Base so erfolgreich verteidigt, erhält er den Spitznamen „Blockade Billy“. Sein Trainer Granny Grantham entdeckt jedoch, dass der Nachwuchsstar ein Geheimnis hat. Am Ende wird der Verein froh sein, Billys Namen aus seinen Annalen gelöscht zu haben.
Der Twist ist gelungen. Deshalb wird er hier auch nicht verraten. Es ist für diese Geschichte nicht mal notwendig, sich mit Baseball-Historie der 1950-Jahre auszukennen oder gar die Regeln zu verstehen. Der Monolog des alten Trainers Grantham entwickelt sich auch so zum Sog.
„Blockade Billy“ zeigt, dass Sportler, wie man so schön sagt, „auch nur Menschen sind“. Oder: dass sie natürlich Menschen sind. Und wozu sie in der Lage sind.
63. Finder’s Keepers (2015, deutsch: „Finderlohn“) ★★★
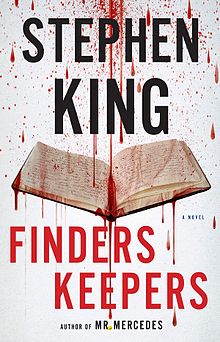
Stephen King: die besten Bücher – Plätze 70 bis 61. Der zweite „Bill-Hodges-Roman“ ist eine „Liebeserklärung an die Literatur“. Spiegelt aber auch die Angst Kings wider, dass Fans zu Fanatikern werden könnten. „Finder’s Keepers“ ähnelt daher „Misery“. Hier aber wandert, im Gegensatz zu „Misery“, der irre Fan erstmal ins Gefängnis. Und der Autor wird ermordet. Beide, Annie Wilkes aus „Misery“, wie dieser Bubikopf Morris Bellamy, sind Psychopathen.
Obwohl der „Finderlohn“ nahezu dieselbe Belegschaft wie aus dem ersten Hodges-Roman auffährt, „Mr. Mercedes“, stürzt sich der Privatdetektiv in ein neues Abenteuer. Diesmal will er eben jenen Bücherliebhaber stoppen, der sein Idol einst ermordete. Morris Bellamy war mit der Entwicklung einer Figur nicht einverstanden. Und erschießt den Schriftsteller John Rothstein (der Name dürfte an Philip Roth angelehnt sein). Er stiehlt Notizbücher mit unfertigen Geschichten, vergräbt sie. Und wandert wegen eines anderen Verbrechens ins Gefängnis. Ein Junge namens Pete Sauber entdeckt Jahrzehnte später die Schriften und erkennt, welchen Schatz er da ausgebuddelt haben könnte.
Was ist Literatur wert?
So ist „Finder’s Keepers“ auch eine Story über den Wert der Literatur, nicht nur dem geistigen Wert, sondern eben auch dem monetären. Pete liebt Bücher, aber seine Familie – sein Vater wurde einst vom Mercedes-Killer“ schwer verletzt – braucht das Geld. Der Junge bilanziert, was wichtiger ist: der unentdeckte Schatz eines großen verstorbenen Schriftstellers oder das Überleben in prekären Situationen. Die Geschichte ist derart gut, dass die eigentliche Hauptfigur, der pensionierte Cop Bill Hodges, erst spät ins Spiel kommen braucht.
Der Junge und der Mörder sind sich dabei nicht unähnlich. In der finalen Konfrontation geht es darum, ob das Leben seiner Familie gegen die Notizbücher eingetauscht werden kann. Pete hält ein Feuerzeug über die tausenden Seiten Papier. Dass der eine verbrennen wird, weil er die Literatur retten will, ist ein Bekenntnis Kings zum Wert der Wörter. Es gibt, in dieser dramatischen Situation, gar einen Schlenker zur „Spoiler!“-Kultur (später auch das gewohnt harte Urteil über Hemingway).
Dazu streut King Bewertungen des Literaturbetriebs ein, betont die Großen (Graham Greene) und die, die nicht mehr recht im Bewusstsein sind (W. Somerset Maugham). „Ich habe ihn nicht wegen Geld umgebracht!“, sondern: „Weil er seine Ideale verraten hat!“, sagt der Killer. Das Werk hatte sich in eine andere Richtung entwickelt. Und es war wichtiger als der Autor.
62. Charlie The Choo-Choo (2016)★★★
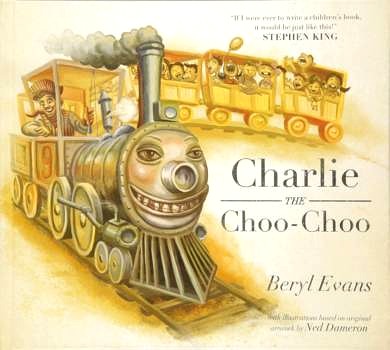
Stephen King: die besten Bücher – Plätze 70 bis 61. Das erste Kinderbuch seiner Karriere –nicht, dass eines überhaupt erwartet worden wäre – veröffentlichte King mit 69. Unter dem Pseudonym Beryl Evans erzählt er auf 24 bebilderten Seiten die Geschichte des Zugs Charlie The Choo-Choo (auf Deutsch wurde das Werk noch nicht übersetzt), den Leser aus dem „Dunkle Turm“-Zyklus kennen.
Junge (und ältere!) Leser sollen aus der Lektüre sicher mitnehmen, dass hässlich sein nicht gleich schlechter sein bedeutet. Charlie ist eine alte ausrangierte Lokomotive, die einem neuen Modell Platz machen und aufs Abstellgleis geschoben werden soll. Nur Zugführer Bob, der als einziger weiß, dass die Maschine auch sprechen kann, glaubt an ihn.
Die Kinder brüllen
Nur ist Charlie wirklich eine unangenehm anzusehende Lokomotive (fürs Artwork zeichnete Ned Dameron verantwortlich, der auch den „Dunklen Turm“ illustrierte). Selbst traurig sieht er, mit seinem abstoßenden Maul und den scharfen Augen, wie ein Killer-Roboter aus. Wenn er lacht, möchte man sich so weit wie es geht von den Gleisen entfernen. Gemeinsam fahren die Zwei durch karge Western-Landschaften.
Es ist eine hinterlistige, gemeine Art, wie Stephen King uns diesen Zug und den vor Hingabe blinden Lokfahrer Bob verkaufen will. In der Welt der beiden Freunde ist nicht für viel anderes Platz als die rasante Fahrt. Ob mit oder ohne Passagiere. Hat Charlie den Menschen verzaubert?
Nicht ein bösartiges Wort fällt in dieser Geschichte. Aber das Schlussbild sagt alles. Charlie und Bob sind wieder im Geschäft. Die Waggons sind voll, und der eine strahlt naiv, der andere grinst wissend.
Nur der genau Blick in den Wagon zeigt, dass die Kinder vor Angst schreien. „Stelle mir keine komischen Fragen, dann spiele ich keine komischen Spiele“, singt der Zug seinem Zugführer Bob freundlich entgegen. Im Laufe der Geschichte hatte Bob eben sehr viele Frage an seinen künstlichen Freund gestellt. Vielleicht ist das die Ironie. Der unbedarfte Bob, der die Dinge hinterfragt, hat das ganze Drama erst ins Rollen gebracht.
61. Roadwork (1981, deutsch: „Sprengstoff“, als Richard Bachman) ★★★
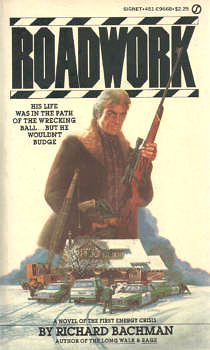
Stephen King: die besten Bücher – Plätze 70 bis 61. So wie schon das Bachman-Buch „Rage“ (über den Amoklauf eines Schülers) ist „Roadwork“ eher Gesellschafts- als Horror-Roman. King schrieb es unter dem Eindruck der Ölkrise, die 1973 mit einem Schlag die Abhängigkeit der westlichen Länder von den arabischen Staaten demonstrierte.
Die Weltordnung bricht auch für Barton George Dawes zusammen, als er erfährt, dass sowohl sein Haus auch als sein Arbeitsplatz einer Autobahn weichen soll. Der Mann, der zuvor schon seinen Sohn verlieren musste und dessen Ehe zu zerbrechen droht, weiß sich nicht anders zu helfen, als sich mit Waffen einzudecken. Und es den Stadtplanern so schwer wie möglich zu machen. Ein echter Prepper.
„Roadwork“ ist auch ein echtes Stück Lesearbeit. Über den unsympathischen Dawes kann man nur den Kopf schütteln. Weil er mit zunehmenden Ideen immer planloser agiert. King selbst würde sich mit diesem Roman in der Bewertung schwer tun. Er verarbeitete damit den Krebstod seiner Mutter. Transferierte in das Buch jedoch nur ein diffuses Gefühl von Hilflosigkeit. „Roadwork“, gedacht als der Versuch in einem neuen Genre, sollte 1981 also auch Kings erstes mittelmäßiges Buch sein.
Immerhin gibt es einige Querverweise zum „Mangler“ aus der „Night Shift“-Kurzgeschichte, die Dawes als Leiter seiner Wäschereiabteilung ja auch befehligt. Auf dass dieser gefräßigen Maschine keiner zu nahe kommt!