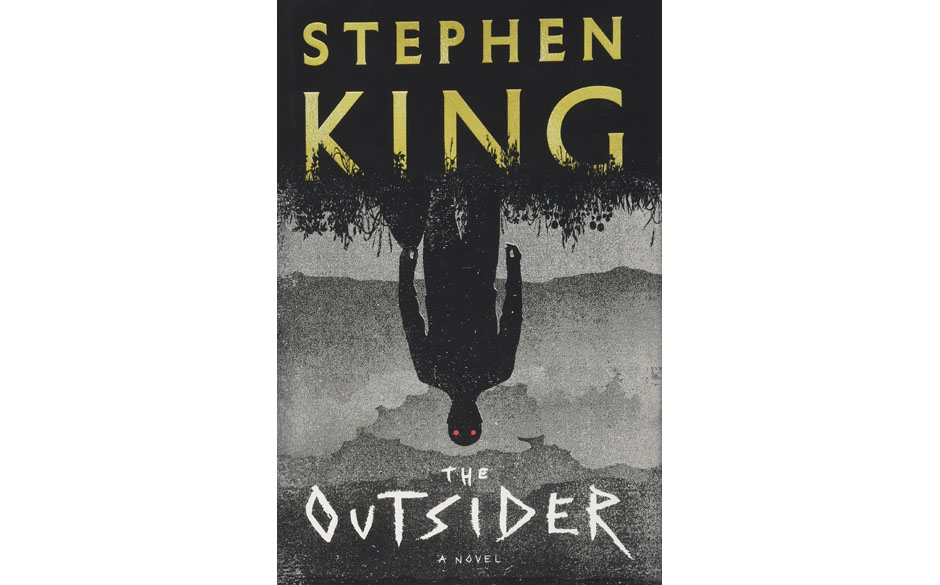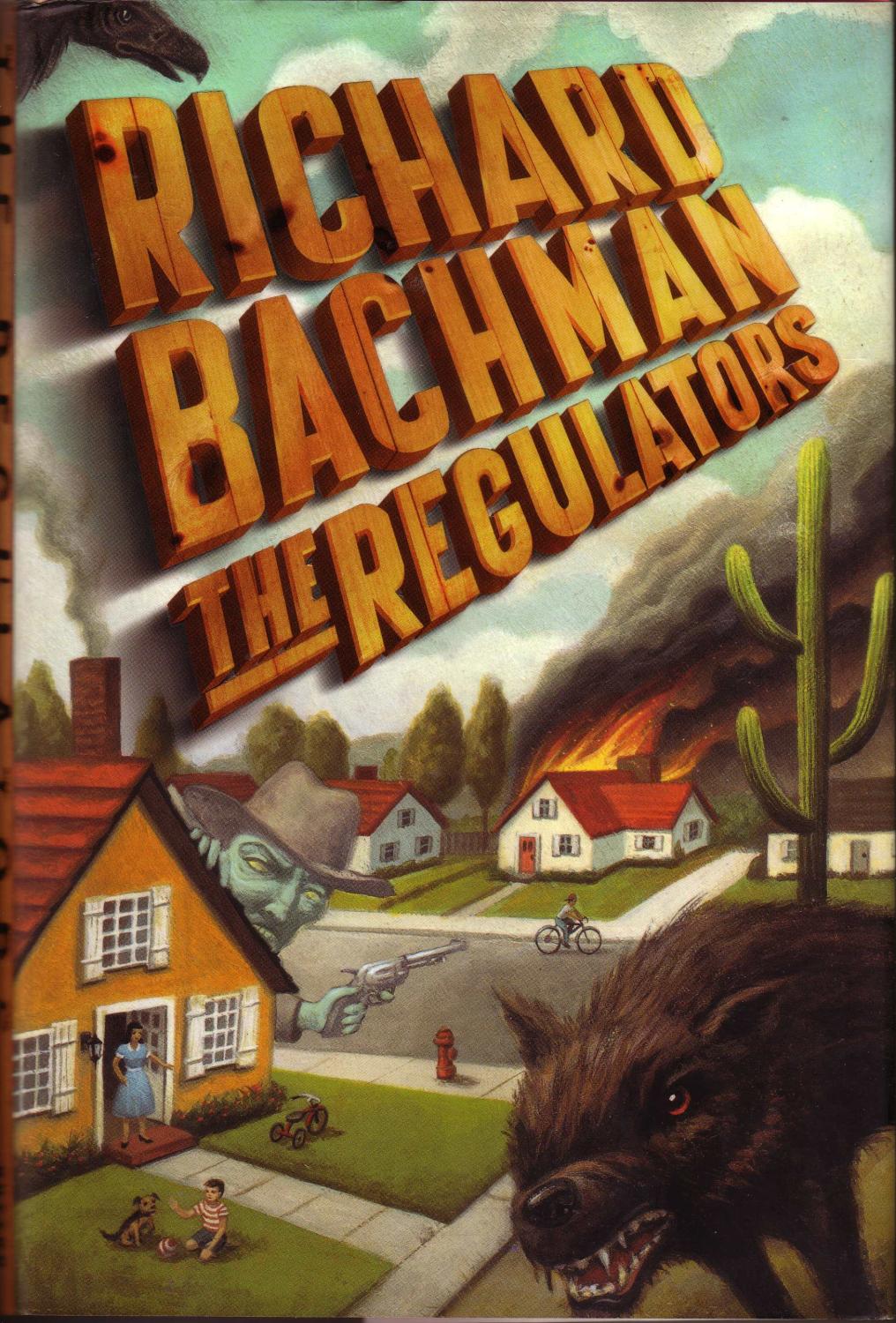Stephen King: die besten Bücher – Plätze 60 bis 51
Stephen King: Alle Romane, Kurzgeschichten und Novellen-Sammlungen im Ranking. Sehen Sie hier die Plätze 60-51.
Stephen King – Das Ranking
-
Plätze 81-88
-
Plätze 80-71
-
Plätze 70-61
-
Plätze 60-51
-
Plätze 50-41
-
Plätze 40-31
-
Plätze 30-21
-
Plätze 20-11
-
Plätze 10-01
60. „Black House“ (mit Peter Straub, 2001, deutsch: „Das schwarze Haus“) ★★★
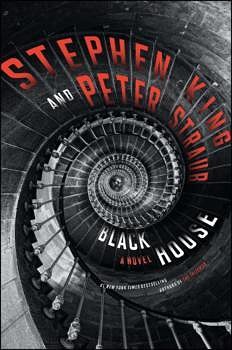
Stephen King: die besten Bücher – Plätze 60 bis 51.Die größte Ähnlichkeit hat dieser zweite „Talisman“-Roman vielleicht gar nicht mit dem ersten Buch, mit allem, was in den „Territorien“ bzw. Mittwelt spielt, oder gar Poes hier viel zitiertem „Der Rabe“. Die größte Wesensverwandtschaft hat der Held Jack Sawyer womöglich mit Danny Torrance aus „The Shining“. Beide trugen als Kinder schwer an ihren übersinnlichen Fähigkeiten. Und so, wie Danny setzt auch Jack als Erwachsener seinen Sinn ein, um anderen Menschen zu helfen. In der „Shining“-Fortsetzung „Doctor Sleep“ versucht Danny ein Mädchen zu retten; in „Black House“ will Jack, ein pensionierter Polizist, einen Jungen aus den Klauen des Serienmörders „Fisherman“ befreien.
Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen „Doctor Sleep“ und „Black House“: Die Gegner erweisen sich am Ende als außerordentlich schwach. King und Co-Autor Peter Straub fahren, wie schon im „Talisman“, die große Blitzschlag-Parade auf. Damals erledigte Jack seinen „Onkel“ Morgan Sloat, diesmal muss Lord Munshun (Diener des Scharlachroten Königs) daran glauben. „Ein weiterer, reinweißer Lichtstrahl schießt vom abgewetzten silbernen Ring“ usw. Es ist die einfache, eben gleißende Art, sich eines Gegners zu entledigen, wenn sich dessen tödliche Kraft nur schwer beschreiben lässt. Etwas launisch beschreibt King selbst diesen Kampf als „Showdown“, eine „archetypische Szene aus zehntausend Westernfilmen“.
Geisterhaus-Experten
„Hier geht’s um den Dunklen Turm“, heißt es an einer Stelle sehr direkt – also um die Verknüpfung zum wichtigsten Werk im Leben des Stephen King. Aber die Stärke des Romans liegt in der Beschreibung des „Schwarzen Hauses“ an sich („Black House und darüberhinaus“ ist ein Kapitel fast schon Kubrick-artig betitelt um dessen unendliche Größe anzudeuten). Der Geisterhaus-Experte der beiden ist Peter Straub („Ghost Story“), und in der komplexen Darstellung des Waldhauses, das durch seine Gestaltveränderungen jeder architektonischen Beschreibung trotzt, zeigt sich sein Vermögen.
Das beste Zitat gebührt natürlich dem blinden Disc-Jockey und Alleinunterhalter George Rathbun. „Ich kann Auto fahren, weil Ray mich eines Nachts in Seattle vor 40 Jahren zu einer Spazierfahrt eingeladen hat“, versichert er seinem Freund Jack Sawyer. Und mit Ray ist Ray Charles gemeint. „Lief wie geschmiert. War überhaupt nichts dabei. Wir sind natürlich auf Seitenstraßen geblieben, aber Ray ist fast hundert Sachen gefahren, das weiß ich ziemlich sicher.“
Zwischen dem „Talisman“ und „Black House“ vergingen 17 Jahre. Ein drittes Buch hätte 2018 folgen können. Kommt Band drei noch?
59. The Institute (2019, deutsch „Das Institut“) ★★★
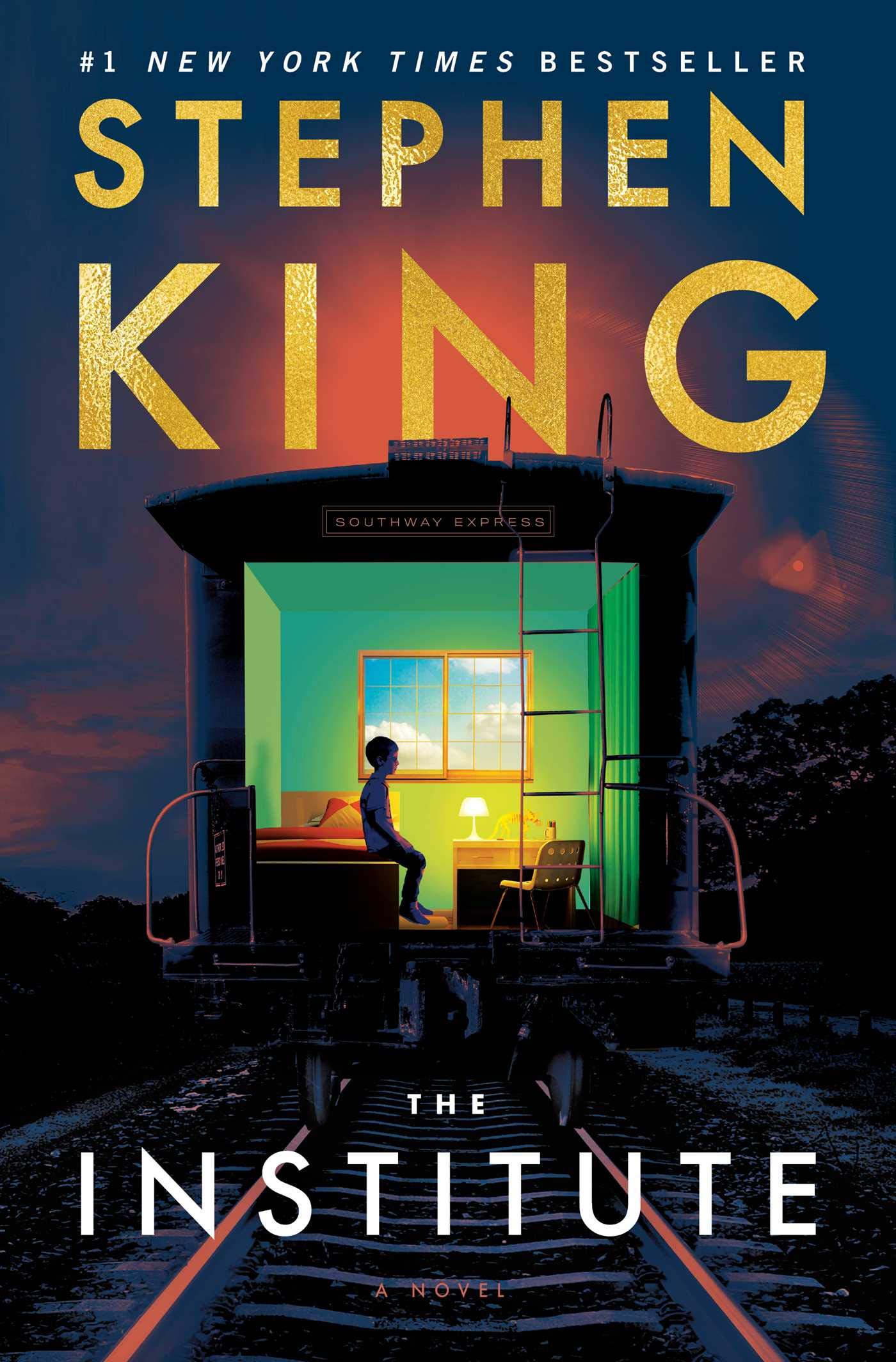
Stephen King: die besten Bücher – Plätze 60 bis 51. Es scheint Stephen King nur noch schwer möglich zu sein, einen Roman ohne direkte politische Anspielung auf das Amerika unter Trump zu schreiben. Schon vor dessen Amtsantritt hatte er ja über den verrückten Millionär philosophiert („Under The Dome“), aber seit der ins Weiße Haus eingezogen ist, arbeitet King sich an ihm unermüdlich ab. Manchmal wünscht man sich die einfachen Zeiten zurück, in denen Kings Romane einfach nur Horror-Geschichten waren, ohne Bemühung, die Zeichen der Zeit zu beschreiben: „Pet Sematary“, „Shining“ …
Nun auch im „Institut“. Telekinetisch und telepathisch begabte Kinder werden entführt und in den Wäldern Maines im „Institut“, einem Geheimbau der Regierung, gefangen gehalten. Mit ihren Kräften soll der Weltfrieden gewahrt werden, indem die Kids böse Staatenlenker, Terroristen oder Religionsfanatiker Kraft der Gedanken aus der Distanz ausschalten.
Im Zuge des King-Revivals und der Referenzen an dessen Werk in der immens populären „Stranger Things“-Serie war davon auszugehen, dass nun auch beim Meister coole Zauber-Kids mit markigen Sprüchen für klare Verhältnisse sorgen würden. Aber das ist in diesem Buch nicht der Fall. Die Prozesse sind derart kräftezehrend, dass die Kinder am Ende, dann nur noch „Rüben“ genannt, vor sich hinvegetieren – bis ihre Leichen in einem Krematorium verbrannt werden. Sie werden, verdreckt, nackt, auf Matratzen in einer Halle gehalten – hier standen die „Auffanglager“ an der texanischen Grenze zu Mexiko Pate, wo die kleinen Migranten in Trumps Amerika von ihren Eltern getrennt, verdreckt, nackt, auf Matratzen in einer Halle gehalten werden.
Grandioses moralisches Dilemma
Das „Institut“ skizziert zumindest ein grandioses moralisches Dilemma: Dürfen, sollten einige wenige Menschen sterben, damit das Wohl der Menschheit gewahrt bleibt? Die Betreiber der Einrichtung, allesamt Ex-Spitzenkräfte aus Militär und Geheimdiensten, sprechen von einem „Gleichgewicht des Schreckens“, einer Art Tauschhandel: Durch den Mord an ein paar Kindern werde die Menschheit davon abgehalten sich selbst auszurotten.
Die Geschichte wäre jedoch um einige Klassen mutiger, brisanter und realistischer geworden, hätte Stephen King sich getraut diese Ambiguität, das Nichtwissenkönnen, ob der Tod der Kinder wirklich der größeren Sache dient, bis zum Ende aufrechtzuerhalten. Stattdessen fährt er auf den letzten Seiten schwere Geschütze auf um die Instituts-Schergen als größenwahnsinnig darzustellen.
Haben Sie schon mal von der Bernoulli-Verteilung gehört?
Haben Sie schon mal von der Bernoulli-Verteilung gehört? Der Autor dieser Zeilen muss zugeben, dass er diese Verteilung nicht kannte. King erwähnt nun dessen fundamentale Bedeutung. Ich musste nachschlagen, es gibt sie wirklich, diese Verteilung. Aber das ist nicht der eigentliche Punkt, der Grund dafür, warum King der Mut verlassen hat.
Der Punkt ist, dass es fußlahm bis arg konstruiert wirkt, wenn sich auf den letzten Metern mittels, ich nenne es jetzt einfach mal: Matheformeln mit tollen Namen, die Argumentationen der Bad Guys in Rauch auflösen sollen. Vereinfacht gesagt: Die Bernoulli-Verteilung soll erklären, dass das Institut auch falsch liegen kann – da es nur zwei Ausgänge für Zufallsereignisse geben könne; zum Beispiel „Kopf“ oder „Zahl“ beim Werfen einer Münze. Noch einfach gesagt: Man hätte nicht mit Gewissheit sagen können, dass die ihrer Lebenskräfte beraubten Kinder für einen „guten Zweck“ gestorben sind, nur weil die Instituts-Mörder per Fifty-Fifty-Chance richtig liegen können.
Moralisches Dilemma
Bisweilen liest es sich so, als wäre die erwachsene Figur des Tim Jamieson, ein aufrechter Ex-Cop, nur ins Spiel gebracht worden, um die Macht des Zufalls zu demonstrieren: Er rettet den kleinen, geflohenen Luke. Aber das nur, weil er in den Wochen und Monaten zuvor spontane Entscheidungen getroffen hat. Er verlässt freiwillig ein überbuchtes Flugzeug, er lässt sich per Anhalter mitnehmen, die ihn in die Stadt DuPray führen, wo der der telepathisch begabte Flüchtling am Ende eben auch landet. Seht hier, scheint King zu sagen: Was auch immer die vom „Institut“ euch weismachen wollen, es hätte eben auch ganz anders kommen können.
„Wer bei klarem Verstand ist, opfert auf dem Altar der Wahrscheinlichkeit keine Kinder, das hat mit Wissenschaft nichts zu tun“, werfen die Helden dem Chef der Entführerbande entgehen. Sie halten ihm Bernoulli entgegen. Dagegen lässt sich nichts sagen – aber es bleibt der beunruhigende Gedanke, dass viele der Geheimdienstler Überzeugungstäter sind, die wirklich glauben für das Gute zu kämpfen. Und von eben diesem daraus resultierenden, moralischen Dilemma kann man sich schwerer frei machen, als es sich liest.
Mengele und Vietnam
„Das Institut“ ist einer jener King-Wälzer, wie eben „Under The Dome“ oder auch „Sleeping Beauties“, die nur so vor Vergleichen strotzen: My Lai, der Vietnamkrieg; die „Rüben“ werden zu afro-amerikanischen Sklaven in Beziehung gesetzt; die angedrohte Vergasung der rebellierenden Kinder ist die „Endlösung“, der Instituts-Arzt ein Josef Mengele; die beschönigend als „erweiterte Verhörmethode“ gekennzeichnete Folter wurde aus dem Irak-Krieg mitgebracht; ein Präsident wie Donald Trump, der droht den roten Knopf zu drücken, sei ja selbst, wie die Instituts-Insassen, ein Kind usw.
Das sind wenig subtile Allegorien, aber dem Thema Massenmord an Kindern angemessen. Ärgerlicher ist da schon die Erzählmethode, die geheime Geschichte des „Institut“ nicht, wie es sich gehört, durch die Hauptfigur Luke aufdecken zu lassen, sondern per an ihn gerichteten Vortrag, einer Videoaufnahme der Putzhilfe Maureen. Sie berichtet ihm alles, von A-Z, jedes Mysterium wird erhellt. Wenn dahinter nicht Faulheit Kings steckt, so ist das dennoch ein No-Go beim Versuch eine gute Geschichte zu konstruieren.
Es sind zwei andere Aspekte, die das „Institut“ zwar nicht mehr zu einem guten, aber zumindest ordentlichen Roman machen. Die Story des Flüchtlings Luke wird die des Hobos: Unterm Zaun durchgekrochen, durch den Wald geirrt, auf einem Boot auf dem Fluß getrieben, und dann heimlich in den Güterwagen, die Ostküste entlang. Es ist die sehr amerikanische Geschichte des Entdeckers.
Erwachsene fliegen in Stücke
Von ähnlicher Kraft sind die Coming-of-Age-Momente der traumatisierten jungen Gefangenen. Den Eltern entrissen, müssen sie schnell erwachsen werden. Fremde Menschen misshandeln sie. „Die Ohrfeige war richtig schlimm gewesen. Aus vielerlei Gründen.“ Solche Sätze sitzen, weil sie die sprachliche Ohnmacht der Kinder Ausdruck verleihen. „Unerschütterliche Annahmen“ über Erwachsene fliegen in Stücke, „zum Beispiel, dass sie nett zu einem waren, wenn man nett zu ihnen war.“
Aber es ist ja nicht so, dass diese pubertierenden Kids unter ihren Fähigkeiten ausschließlich leiden würden. In dem Alter, wo Getuschel und Gerüchte zum Lebensinhalt gehören, haben sie den normalen Kindern etwas voraus: Man telepathiert eben nicht mit jedem. Das ist Insider-Kommunikation. Diese Kleinen können dann, zumindest nach außen hin, recht cool wirken.
58. Holly (2023) ★★★

Stephen King: die besten Bücher – Plätze 60 bis 51. Ob Donald Trump seinem scharfen Kritiker Stephen King jemals antworten wird? Seit 2016 arbeitet sich der „Meister des Horrors“ am Ex-Präsidenten ab, dem Ork mit der orangefarbenen Haut und der erdbeerfarbenen Frisur (von der Existenz dieser Haartönung wissen wir auch erst seit dem Mugshot-Steckbrief), ohne dass der ihm auch nur ein einzelnes Mal eine Replik geschenkt hätte.
Ob im „Institut“, in „Billy Summers“ oder „If It bleeds“, King hat sich derart auf Trump eingeschossen, dass es nicht bei spitzen Verweisen auf dessen desaströse Politik und seinen anhaltenden schädlichen Einfluss auf die Welt bleibt, sondern Analogien zum ehemaligen POTUS fast schon den Handlungsrahmen der King-Storys bilden. Man freut sich mittlerweile schon auf mittelmäßige Bücher wie „Fairy Tale“, weil sie in einer (Fantasy-)Welt spielen, in der The Donald nicht vorkommen könnte.
Womöglich fühlt King, Jahrgang 1947 und damit nur ein Jahr jünger als Trump, sich dauerbeflügelt, weil er mit „The Dead Zone“ von 1983 und „Under the Dome“ von 2009 zum Propheten wurde: Die Romane handeln von Machtmenschen mit Trumpschem Größenwahn. Präsidentschaftskandidat Greg Stillson und Stadtrat Jim Rennie tragen Trumps Wesenszüge, und er trägt ihre.
King liefert die Zustandsbeschreibung einer USA
Jede Kritik an Donald Trump ist berechtigt, nur leidet Kings neuer Roman „Holly“ unter dieser Fixierung wie kein Roman davor. Es macht King, den erfolgreichsten Schriftsteller der Welt, auch ein wenig uncool. Trump-Wähler, MAGA-Rotkäppis, Querdenker, Verschwörungstheoretiker, Impfverweigerer – King liefert die Zustandsbeschreibung einer USA, die komplett irre geworden zu sein scheint. Die Leute, die den eher linkspolitischen King (der bis Ende der 1960er-Jahre noch ein Republikaner war) nicht lesen, wird er nie erreichen. Für alle anderen, seine Leute, gilt: he’s preaching to the choir.
King hat außerdem ein Händchen für äußerst problematische Darstellungen von Frauenfiguren. Stets verteidigt er das Prinzip der selbstbestimmten Entwicklung seiner Heldinnen – und merkt anscheinend nicht, dass er sie alle erst durch einen Mentor eine gewisse geistige Reife sowie Schlagkräftigkeit erreichen lässt, nicht etwa durch die – Achtung, Modewort – „Selbstermächtigung“. Ohne den mittlerweile verstorbenen, älteren Detektiv Bill Hodges jedenfalls wäre Romanheldin Holly Gibney nicht die geworden, die sie heute ist.
Es ist äußerst unangenehm zu lesen, wie King die Mittvierzigerin Holly Gibney, eine Neurotikerin mit Zwangsstörungen, verniedlicht
King liebt seine Holly. Im reichen, auf die 100 Bücher zustreben King-Output nimmt die Ermittlerin eine Spitzenposition ein: Hauptcharakter in zwei Romanen, von denen nun einer nach ihr benannt wurde („Holly“, davor war sie in „The Outsider“), Nebenfigur in drei Romanen (die „Bill-Hodges-Trilogie“) sowie Hauptfigur in einer Kurzgeschichte („If It Bleeds“). Abgesehen vom „Dunklen Turm“-Ensemble, das sich aufgrund der episodischen Erzählung in bis zu acht Romanen entfaltet, gibt es niemanden, dem King sich ausgiebiger gewidmet hat.
Es ist äußerst unangenehm zu lesen, wie King die Mittvierzigerin Holly Gibney, eine Neurotikerin mit Zwangsstörungen, verniedlicht. Er verniedlicht viele seiner erwachsenen Frauen. Am schlimmsten die „kleine Lisey“, einer Frau über 50, aus „Lisey’s Story“ – ausgerechnet jener Roman, den er als seinen besten bezeichnet, was einigermaßen tief blicken lässt.
Holly findet vieles „bäh“
Holly findet vieles „bäh“ und nimmt sich selbst bei ihren Bäh-Erlebnissen, ganz Kleinkind, in der dritten Person wahr („Holly hasst Schlangen“). Und wenn sie auf der richtigen Fährte ist, spürt sie sogleich die „Holly-Hoffnung“.
Aber sie ist auch ein Ermittlergenie, das sich in Momenten größter Anspannung nicht aus der Ruhe bringen lässt. Die Neurotikerin Holly als eine Frau mit vermeintlich kühlem Kopf gegen Coronaleugner antreten zu lassen, erscheint zunächst gewagt, wie eine Selbstentwaffnung. Allerdings sind Hollys auf Recherchereise getroffenen Schutzmaßnahmen – Masken, Desinfektionsmittel – in einem vom Lockdown aufgewühlten Land und im Kontakt mit den unzähligen, an alternative „Wahrheiten“ glaubenden Mitmenschen eben auch vernünftig.
Sind die Manierismen aus dem Lexikon der Verhaltensauffälligkeiten gerade noch akzeptabel, werden die Anti-Trump-Suaden nahezu in Listicle-Form dargeboten, denn es muss ja Platz für alles bleiben, was seit 2016 passiert ist.
NRA-Anhänger, die Töchter verstoßen
„Tränen der Erleichterung“, als Biden die Wahl gewonnen hat, „Tränen des Zorns“ beim Sturm auf das Kapitol und der „Diebstahl“ der Wahl durch die Demokraten; der Coronatod von Hollys Mutter, einer impfunwilligen Trump-Anhängerin; die Frage, ob der Virus in einem Labor in Wuhan entstanden ist; NRA-Anhänger, die Töchter verstoßen, weil die ihre durch Vergewaltigung gezeugten Föten abgetrieben haben; Freisprüche für Weiße Polizisten, die einen Schwarzen Teenager mit defektem Autorücklicht bei einer Verkehrskontrolle erschießen; den Staatsdienst quittierende Beamte, die der „Corona-Diktatur“ nicht folgen wollen und deren Verlust dann schmerzlich registriert wird, wenn nicht mehr genug von ihnen da sind, um die Protestierenden der Black-Lives-Matter-Bewegung vor fanatischen Gegendemonstranten zu schützen.
Hinter dem Polit-Rant verbirgt sich eine bemerkenswerte Geschichte über wahre Monster: Verschwörungstheoretiker, die zu Kannibalen werden. Sie glauben, durch den Verzehr von Menschen den Alterungsprozess aufheben zu können. „Holly“ ist Kings erster Roman seit „Blaze“ von 2007 (der wiederum auf einer unveröffentlichten Erzählung aus den 1970er-Jahren beruht), in dem der Schrecken nicht übernatürlichen Ursprungs ist.
Die Realität Amerikas scheint King mittlerweile ein größeres Grauen zu sein. Bedauerlich, dass er das auf den letzten Seiten selbst betonen muss, nicht mit Hollys, sondern seiner eigenen Erzählstimme: Jenes geriatrische, auf Opfersuche gehende Professorenpaar, das durch Verzehr von Menschenfleisch auf Verjüngungseffekte hofft, aber auf einen Placebo-Effekt hereinfällt, sei schlimmer als die Kreaturen aus dem Jenseits, denen Holly sich zuvor stellen musste – den „Outsidern“, die Gestaltwandler Terry Maitland und Chet Ondowsky.
Eine im Käfig gefangene Frau
King ordnet hier selbst sein eigenes, neues Werk als singulär ein. Als würde er uns nicht zutrauen, diese Schlussfolgerung selbst zu ziehen, sofern wir ihm die Besonderheit dieser vorliegenden Erzählung zugestehen. Genauso muss er zweimal aufschreiben, was uns selbst als verblüffende Erkenntnis gekommen ist: Eine im Käfig gefangene Frau kann aus dem Käfig heraus zwei Menschen töten.
Mit Argumenten kann man dem Ehepaar Harris jedenfalls nicht kommen
Per Van und Rollstuhl gehen die Alt-Akademiker Emily und Rodney Harris in „Holly“ auf Beutefang. Doch die von King nachträglich verharmlosten „Outsider“ erscheinen doch etwas agiler als das keifende Rentnerduo, dem King eine Tea-Party-Mindset-Vollausstattung verpasst: Sie sind Nixon-Verehrer, Trump-Bewunderer („ein Zauberer mit Abrakadabra“), Fauci-Feinde und, was sich bei Tea-Party-Anhängern natürlich nicht generalisieren lässt, Rassisten.
Was vielleicht ein bisschen zu viel ist, um aus Feindprojektionen glaubhaft wirkende Charaktere zu machen. Mit Argumenten kann man dem Ehepaar Harris jedenfalls nicht kommen – fragen die beiden sich eigentlich, ob man sich durch den Verzehr rohen Menschenfleischs nicht auch mit Covid anstecken kann? –, und es ist zumindest eine gelungene Pointe, dass Holly die beiden buchstäblich zu fassen kriegen wird, als die mit ihrem Gefasel aufhören und sich ihr bis auf wenige Zentimeter nähern, also ungewollt in den 1:1-Combat gehen.
Hollys Recherchen zu den Entführungsopfern werden durch die Coronapolitik erschwert. Das ermöglicht zumindest immer dann stärkere Passagen, wenn King den Hinterbliebenen der Verschwundenen keine Reden in den Mund legt, die wie Statements des Autors wirken: Rettungsdienste kommen nicht durch, weil das Personal erkrankt ist, oder sie kommen gar nicht erst, da das Personal sich in den Hospitälern um Erkrankte kümmern muss; und die Flure der Hospitäler sind überfüllt.
„Töte deine Lieblinge!“ lautete Kings früheres Motto. Heute heißt es: Lasst meine Lieblinge in Ruhe!
Hollys Gemeinde hat sich in den mittlerweile sechs Erzählungen stark verfestigt, Pete Huntley ist noch da, auch das Geschwisterpärchen Jerome und Barbara Robinson. Der späte Stephen King ist ein gnädiger, er lässt die meisten seiner Protagonisten mittlerweile am Leben, womöglich hätte die tödliche Opferung einer Hauptfigur jedoch der einen oder anderen Erzählung der vergangenen 20 Jahre, auf jeden Fall dieser, gutgetan.
„Töte deine Lieblinge!“ lautete Kings früheres Motto. Heute heißt es: Lasst meine Lieblinge in Ruhe! Den jungen Barbara und Jerome steht eine große Karriere als Autoren bevor, die lyrisch hochbegabte Barbara wird in den Rang einer Amanda Gorman erhoben (King selbst zieht den Vergleich, er drängt sich aber schon sehr früh auf), darf sich auf einen TV-Auftritt bei natürlich Oprah Winfrey freuen – über die Frage „transzendiert Lyrik Rassismus?“ muss sie dann aber doch nachdenken. Ein weiteres Feld, das King wacker beackert.
Stephen King liebt die Bill-Hodges-Gang
Streng genommen hätte King sowohl auf Barbara als auch Jerome für diese Erzählung verzichten können, beide sind für die Entwicklung der Ereignisse nicht wirklich relevant – nur die Befreiung Hollys am Ende hätte er neu denken müssen. Barbaras Funktion als Retterin in letzter Not besteht darin, auf Hollys dringliche Bitte hin den Revolver abzulegen, mit dem sie das fremde Haus, in dem ihre Freundin gefangen gehalten wird, betritt. Holly befürchtet, Barbara könnte von der sogleich alarmierten Polizei als Einbrecherin wahrgenommen, und, weil, sie Schwarze ist, erschossen werden.
Stephen King liebt die Bill-Hodges-Gang; sollte er im Jahr 2024 tatsächlich mit „We think not“ den nächsten Holly-Roman veröffentlichen, die siebte Holly-Story in zehn Jahren, werden dann auch Jeromes und Barbaras Abenteuer weitergesponnen?
King ist, auch mit bald 76 Jahren, der wahrscheinlich betriebsamste Schriftsteller-Millionär (oder ist er schon Milliardär?), der je auf Erden wandelte. Seine Veröffentlichungsquote beträgt aktuell Pi mal Daumen 1,4 Bücher pro Jahr; sein Spitzenwert in den 1980er- bis Nullerjahren betrug drei pro Jahr. Wahrscheinlich ist er auch der verdienteste Super-Schriftsteller, denn er arbeitet derart viel, dass er sein Geld niemals für Weltreisen oder Yachten ausgeben könnte, dafür hat er keine Zeit.
Als er sich 2013 für die „Doctor Sleep“-Lesung nach Europa bemühte, war das eine Sensation. Das Einzige, was King bleibt, worauf er Lust hat, ist Maine im Sommer und das wärmere Florida im Winter. Dort kann er sich über den – von ihm verehrten – Nachbarn Thomas Harris aufregen, weil der in 48 Jahren nur sechs Romane geschafft hat.
Wie beliebt ist Holly Gibney eigentlich?
King scheint sich auch mit 76 bester Gesundheit zu erfreuen, nicht selbstverständlich, er war in den 1970er- bis 1980er-Jahren über einen Zeitraum von zehn Jahren stark kokain- und alkoholabhängig. Irgendwann berichtete er auch mal, langsam zu erblinden, das muss aber mindestens 15 Jahre her sein. Anscheinend kann er mittlerweile blind schreiben. Es darf jedoch auch die vorsichtige Frage erlaubt sein, ob sich die Mehrheit seiner Leser wirklich wünscht, dass King in dieser Phase seines Lebens für die nächsten Jahre plant, weiterhin vorrangig Oden an seine Holly zu publizieren.
Jemand sollte mal eine valide Umfrage erheben: Wie beliebt ist Holly Gibney eigentlich unter Stephen-King-Lesern? Das Ergebnis könnte den Meister vielleicht überraschen. Gibt es möglicherweise andere Charaktere, die man nicht nur in einer oder zwei, stattdessen gerne in sechs – bald sieben – Erzählungen begleiten würde?
Danny Torrance vielleicht, Jack Sawyer, Charlie McGee oder Devin Jones? Ben Mears, das wär’s doch! Und was wird King bloß tun, sollte Holly Gibney irgendwann ein beschwerdefreies Leben führen? Wahrscheinlich würde er genau das nicht zulassen. Aber die Holly-Hoffnung stirbt zuletzt. Bäh?
57. The Dark Man (1969, 2013) ★★★

Stephen King: die besten Bücher – Plätze 60 bis 51. Die Cemetery-Dance-Ausgabe des Gedichts, das Stephen King bereits 1969 veröffentlichte, ist wirklich schön: 88 Seiten mit mehr als 70 Zeichnungen, von Fantasy-Illustrator Glenn Chadbourne, der seit den Spätachtzigern für Arbeiten von King zeichnete. Geschrieben, oder eher: hastig gekritzelt hatte King es einst in einem Diner.
Der „dunkle Mann“, von dem King vor fast 50 Jahren zum ersten Mal erzählte, ist seine wohl wichtigste Figur geworden: Randall Flagg, Prediger des Bösen, der, in staubigen Jeans und Stiefeln gekleidet wie ein Cowboy, durch die USA reist. Als einer der hochrangigsten Schurken aus dem „Dunkler Turm“-Kosmos ist er nicht nur eine Hauptfigur in sieben Bänden der Saga, sondern auch Protagonist in „Das letzte Gefecht“ und „Die Augen des Drachen“ und zuletzt ein fast schon süffisanter, geduldiger Chronist der Welthistorie in „Gwendys Wunschkasten“.
Flaggs Biografie wird im „Dark Man“ noch nicht beleuchtet, er erscheint als Tramper, der einfach der ist, der er ist. In späteren Werken wird er wahlweise erzählen, dass er dem Ku-Klux-Klan angehörte oder ein Vietcong war. Dies macht den Reiz Mannes aus. Er scheint keine aus dem Magischen geborene Kreatur zu sein, sondern einer von uns, der sich zur dunklen Seite hat bekehren lassen (im siebten „Turm“-Band wird im seine menschliche Überheblichkeit zur Schwäche, ein Monster macht mit dem scheinbar Übermächtigen kurzen Prozess).
„I have Fed Dimes To / Cold Machines/“
Das Gedicht ist so zu lesen, wie es die „Cemetery Dance“-Ausgabe von 2013 anordnet, als Fluss von Wörtern über einer apokalpytischen Western-Landschaft voller zerstörter Scheunen, verlassener Jahrmärkte und zugewachsener Eisenbahngleise, auf denen Geier lauern. Es ist eine sehr szenische Struktur (bisweilen nur zwei Wörter pro Seite).
„I have Fed Dimes To / Cold Machines/ In All Night / Filling Stations / While Traffic In A Mad And Flowing Flame / Streaked Red In Six Lanes Of Darkness“.
Inmitten des entvölkerten, verdreckten Amerikas trifft Randall Flagg auf eine wunderschöne, saubere Frau. Er verführt sie, auf die Art, die er als Verführung empfindet. Das Opfer lässt er zurück, als Warnung an alle, die in seinem Reich der Leere einen Platz zum Leben suchen.
Eine harte Pointe am Ende eines Gedichts, das als morbide Naturbeschreibung begann. Aber es soll keiner sagen, er hätte nicht gewusst, was einem Flagg in den nächsten Jahrzehnten noch bieten wird.
56. Later (2021, deutsch „Später“) ★★★

Stephen King: die besten Bücher – Plätze 60 bis 51. Stephen King ist selbstbewusst genug, seine Vorbilder zu benennen, gar, wenn sich seine Geschichte zunächst wie ein Plagiat liest: „Ich kann tote Menschen sehen“, bekennt der junge Jamie. So, wie der kleine Cole in M. Night Shyamalans Horror-Thriller „The Sixth Sense“ (1999) steht Jamie mit seiner Mutter in einem Unfallstau – und betrachtet die übel zugerichtete Leiche eines verunglückten Radfahrers, der sich nun als Geist aufbaut. Als Nachahmer will King sich jedoch nicht verstanden wissen, denn Jamie schießt hinterher: „Allerdings ist es nicht so wie in dem einen Film mit Bruce Willis.“
King hat noch nie bei anderen abgeschrieben, und anders als Cole verwendet Jamie seine übernatürliche Begabung nicht, um Verstorbene, die nicht von ihrem irdischen Leben lassen können, den Weg ins Jenseits zu weisen. Das schaffen die schon von ganz alleine. Jamie wird von anderen Menschen dafür missbraucht, den Geistern Geheimnisse zu entlocken. Er liefert Hinweise, etwa darauf, wo sich der letzte, noch nicht detonierte Sprengkörper des Bombenlegers befindet, der sich selbst in die Luft jagte. Er wird dafür missbraucht, von einem getöteten Drogendealer zu erfahren, wo er die heiße Ware versteckt hält.
Roman über die Ära Obama
„Later“ ist Kings drittes Buch für den „Hard Case Crime“-Verlag (hierzulande erscheint das Buch bei Heyne). Dort, wo er verhältnismäßig kurze Romane publiziert, in denen Kriminalfälle mehr oder weniger übernatürlichen Ursprungs gelöst werden müssen. Beim ausgezeichneten „Colorado Kid“ geht’s weniger um Geister, in „Joyland“ wiederum ist das Whodunnit noch der uninteressanteste Part. „Later“ weicht noch mehr von der Hard-Case-Linie ab, ist kein Detektivroman. Eher eine Reflexion über die Akzeptanz von Andersartigkeit und dem kindlichen Unvermögen, sich der Brutalität der Erwachsenen und deren Möglichkeiten zur Manipulation zu stellen.
Der Titel „Später“ verweist jedoch nicht nur darauf, was der kleine Jamie hätte anders machen können, reagierte er bei Gefahr mit der Überlegtheit und scheinbaren Ruhe der Erwachsenen. Die „dazu komme ich später“-Berichtsstruktur ist auch die eines erwachsen gewordenen Ich-Erzählers, der weiß, wie gute Storys sich aufbauen lassen müssen. Denn im Gegensatz zu Shyamalans Spukgestalten sind Kings Geister nicht immer gleichgültig gegenüber den Lebenden. Der Twist kommt später, am Ende, eben „Später“.
Nebenjob durch Drogenhandel
„Später“ offenbart vielleicht nicht Kings kreativste Ideen, aber er ordnet das Geschehen geschickt in seine Ära ein. Ab den Nullerjahren, mit der Wahl George W. Bushs zum US-Präsidenten, wurde Stephen King, 25 Jahre nach seinem Romandebüt mit „Carrie“, zunehmend zum politischen Autor. „Under The Dome“ fertigte Bush ab, „Das Institut“ Donald Trump. „Später“ spielt 2008, als Obama Präsident ist und die Weltwirtschaftskrise unzählige Lebensgrundlagen vernichtet, was King erstaunlicherweise veranlasst, seine Story mal nicht in ländlichen Gemeinden anzusiedeln, sondern am Ort der Genese des Wirtschaftscrashs, New York.
Vernichtet wird auch die Existenz von Jamies Mutter Tia, einer Literaturagentin; anders als ihre Lebensgefährtin, die Polizistin Liz, ist Tia machtlos gegenüber der Rezession. Liz schlittert von selbst in ihre Krise, sie sichert sich einen vermeintlich abschwungsicheren Nebenjob durch Drogenhandel – und verliert die Kontrolle. Kings Mitleid hält sich jedoch, wie gegenüber allen Wählern der Republikaner, in Grenzen. Liz glaubt nicht daran, dass Barack Obama in den USA geboren wurde; sie wirkt wie ein schwacher, etwas dummer Mensch.
Jamie spricht von Büchern als „Magie zum Mitnehmen“
Wer Kings Literatur der vergangenen Jahrzehnte verfolgt hat, entdeckt in seinen Büchern unzählige Selbstreferenzen – heute spräche man von „Easter Eggs“. Es gibt einen Autounfall vor Jamies Geburt, der sich auf sein Leben auswirken wird, herbeigeführt durch einen Betrunkenen – King wurde 1999 fast von einem mehrfach wegen Alkoholdelikten am Steuer belangten Pickup-Fahrer totgefahren. Jamie spricht von Büchern als „Magie zum Mitnehmen“ – mit dem Spruch bewarb King sich einst selbst.
Aber die eigentliche Pointe des Romans besteht in der nicht wirklich versteckten Kritik am Schriftstellerbetrieb. King amüsiert sich über Trash-Schreiberei à la „Fifty Shades Of Grey“ und stellt, wie zuletzt in „Finder’s Keepers“, die Frage nach wahrer Urheberschaft erfolgreicher Literatur. Welchen Einfluss haben Agenten, vor allem Lektoren für die Sichtbarkeit populärer Stoffe? Wie häufig kommt es vor, dass sie gar heimlich mitschreiben?
Jamies Mutter Tia nutzt die Fähigkeiten ihres Sohns, um mit einem von ihr vertretenen, plötzlich verstorbenen Bestseller-Autoren zu kommunizieren – denn er verstarb, kurz bevor er sein jüngstes Buch abgeben konnte. Tia will an die Inhalte gelangen, um seinen Stoff postum herauszubringen, weil sie Geld braucht. Redigiert hatte sie die verquasten Storys des Mannes heimlich seit Jahren
55. Just after Sunset (2008, deutsch „Sunset“) ★★★
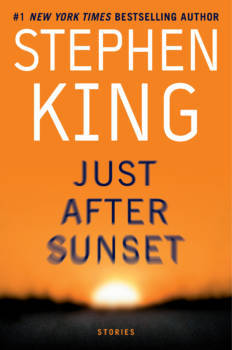
Stephen King: die besten Bücher – Plätze 60 bis 51. Am meisten freuten sich Leser über die „Höllenkatze“, die damals schon 30 Jahre auf dem Buckel hatte, verschiedene Veröffentlichungen durchlief, aber nun endlich in einem Stephen-King-Kurgeschichtenband maunzen durfte. Die Story an sich: Nichts Besonderes, ein mordende Katze, die aus unergründlichen Augen blickt. Eine ganz auf das Schock-Finale ausgerichtete Erzählung.
Wie schreibe ich über eine Atombomben-Explosion?
Und so versammelt „Just after Sunset“ zwar einige seiner größten, aber eben auch einige seiner vielleicht wenn nicht schlechtesten, doch absehbarsten Storys. Vor allem solche, die einem „Was wäre, wenn …?“-Gedanken entsprungen sind. „Der Rastplatz“ ist so eine: Was, wenn ich mal Held spielen soll? – King versuchte, wie er schreibt, seinen „inneren Bachman herbeizurufen“; „Abschlusstag“: Wie schreibe ich über eine Atombomben-Explosion?
„Das Pfefferkuchen-Mädchen“ deutet seine Pointe – Jogging wird das Leben retten – sehr früh an. Extrem unterhaltsam, aber auch ein wenig pubertär ist die Idee, ein Dixie-Klo zur Todesfalle zu machen („In der Klemme“).
King berichtet ja, dass er seine grandiosen Ideen oft aus alltäglichen Situationen zieht. Die Kunst in seinen gelungensten Werken besteht aber meist darin, dass er danach noch einen Schritt weiter gedacht hat. Dass die Geschichte sich nicht mehr auf den Ursprung zurückführen lässt. Einiges in „Just after Sunset“ liest sich, als hätte er seine Gedanken zu schnell aufs Papier gebracht.
„Willa“ und „N.“
„Die New York Times zum Vorzugspreis“ ist das Drama einer Witwe, deren verstorbener Mann anscheinend Kontakt zu ihr aufnehmen will. „Hinterlassenschaften“ ist seine Annäherung an Nine Eleven, den neuen „Prüfstein“ der Geschichte, wie er ihn nennt – eine Herausforderung für heutige Schriftsteller, der auch King sich stellen wollte.
Auch die zwei herausragenden unter den 13 Storys drehen sich um das Jenseits: „Willa“ und „N.“ Zu „Willa“ schreibt King in den Notizen, dass es „wahrscheinlich nicht die beste Geschichte im Buch“ sei, aber ihn reizte die Grundidee, dass man auf irgendeine Weise den Tod überlebt. Und wie romantisch man den Tod doch überlebt. Im Mittelpunkt zwei Liebende, die noch nicht bereit sind, die Welt zu verlassen, weil man ja nicht weiß, was dann kommt. Bleibt man zusammen? Sie raffen sich zu einem letzten Tanz auf.
„N.“ ist, im besten Lovecraft-Sinne, eine Art Tagebuch-Roman: Der Erzähler steht so lange in berichtender Distanz zum Horror, bis der ihn selbst erfasst hat, aber er selbst es nicht erfassen kann, sondern als schleichender Wandel lediglich vom Leser der Aufzeichnungen bemerkt wird. Chronik eines angekündigten Wahnsinns, der sich auf den überträgt, der es liest. „N.“ ist eine der gruseligsten, verstörendsten und faszinierendsten Kurzgeschichten, die King zu Papier gebracht hat; eigentlich ein Fall für eine Sonderveröffentlichung, 72 Seiten wären dafür nicht zu wenig.
Er identifiziert Stonehenge
King schreibt, dass Zwangsstörungen ein zentrales Thema von „N.“ sind. Es geht um einen Patienten mit Zählzwang, der sich als Hüter des Tors zu einer Unterwelt versteht, dessen Dämonen er in Schach halten muss. Das Portal erkennt er in einem Steinkreis auf einem unscheinbaren Feld. Mal sieht er acht Steine, dann sind die Kreaturen gebannt, dann sieben, und es droht eine Invasion, der er Einhalt gebieten muss.
Das Dasein als Auserwählter wird Patient N. zur Last, aber er nimmt die Aufgabe an. Er identifiziert Stonehenge und die Kornkreise ebenso als Kalender, die nicht nur menschliche Daten markieren, sondern auch die Zeiten, in denen mit größerer Gefahr zu rechnen ist. Seine Erkenntnis: „Es ist schon paradox, dass ausgerechnet Verhaltensweisen, die wir als neurotisch betrachten, das Gleichgewicht der Welt bewahren.“
54. Everything’s Eventual“ und „Six Stories“ (1998 bzw. 2002, deutsch: „Im Kabinett des Todes“)★★★

Stephen King: die besten Bücher – Plätze 60 bis 51. So wie „Just after Sunset“ ist diese voran gegangene Kurzgeschichtensammlung weniger der Versuch, das Beste der letzten zehn Jahre zu versammeln, als überhaupt das herauszubringen, was King ab 1994 in verschiedenen Zeitschriften veröffentlicht hatte. Die Qualität der 14 Storys, fünf davon erschienen schon im limitierten Sammelband „Six Stories“, variiert stark.
„Der Mann im schwarzen Anzug“
„Autopsieraum Vier“, „Lunch im Gotham Café“ und „Im Kabinett des Todes“ sind, wie es sie einige Jahre später auch in „Just after Sunset“ geben wird, solche Grundgedanke-Geschichten, „Was wäre, wenn?“-Situationen. Ein Scheintoter, ein Folteropfer, ein Ex-Ehepaar, das in einem Restaurant über die Scheidung reden will und dann von einem irren Keller angegriffen wird. Drei Stories, deren Ausnahmesituationen King vielleicht noch ein wenig hätte weiterentwickeln müssen.
Aber „Everything’s Eventual“ enthält – natürlich! – auch einige seiner besten Kurzgeschichten. Für „Der Mann im schwarzen Anzug“ erhielt King 1996 den O-Henry-Preis für die beste Kurzgeschichte („Ich dachte, da hätte sich irgendjemand geirrt“, urteilte er über die Jury). „L.T.s Theorie der Kuscheltiere“ markiert seinen erfolgreichen Versuch des Tonwechsels innerhalb einer Erzählung, von der Tragikomödie zum Horror. „Alles endgültig“, das dem Buch seinen Originaltitel gab, ist ein raffiniertes Spiel mit der Frage, ob man besondere Begabungen für besondere Zwecke einsetzen darf, wenn der Preis stimmt.
„1408“
„1408“, noch bekannter geworden durch die John-Cusack-Verfilmung, ist als Spukhotelzimmer-Story schleichend gruseliger als der gesamte „Shining“-Roman. Am schönsten jedoch ist „Achterbahn“, das auch als E-Book erschienen ist und zu einem derartigen Verkaufserfolg wurde, dass King das Internet, die „Download“-Funktion und überhaupt die digitale Welt neu zu entdecken schien.
Angst, nicht Feigheit
„’Du bist mein Leben’, sagte ich und gab ihr einen Kuss. ‚Ob es Dir gefällt oder nicht. So ist es nun mal.‘“ Das sagt in „Achterbahn“ nicht der verliebte Mann zu seiner Partnerin, das sagt der Student Alan zu seiner kranken Mutter. King stellt seinen Alan jedoch nicht als Muttersöhnchen bloß, auch, wenn er ihn vor eine harte Entscheidung stellt. Er macht das, was viele Menschen tun, wenn sie mit dem Tod bedroht werden. Den anderen vorschicken. Einer muss sterben, du oder sie: Dann nimm lieber sie als mich! Das ist Ausdruck von Angst, nicht Feigheit, und eine ganz normale Emotion. Nur, dass man nach solchen Entscheidungen bis ans Lebensende damit umgehen muss.
In den Vorwörtern der einzelnen Geschichten schreibt King über Konflikte und Vorlieben: „Das Thema der Horrorliteratur schlechthin: unser Bedürfnis, mit einem Mysterium fertig zu werden, das sich nur mit Hilfe der Fantasie ergründen lässt“ oder „Die Hölle, immer wieder das Gleiche zu tun. Exitenzialismus, Baby – echt ne Bombenphilosophie. Albert Camus! Telefon!“
Nicht zuletzt bezeichnet er „Rose Madder“ als „von allen meinen Romanen wahrscheinlich der lesenswerteste“ – der Mann hat Humor, da sind von ihm ganz andere Bewertungen des Buchs bekannt.
53. Cycle Of The Werewolf (1983, deutsch: „Das Jahr des Werwolfs“) ★★★
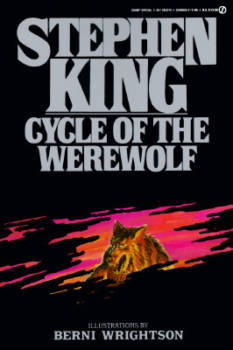
Stephen King: die besten Bücher – Plätze 60 bis 51. Nach Vampiren und Zombies nun die Lykanthropen: Zwölf Monate, zwölf Kurzpisoden über den Angriff eines Werwolfs auf eine kleine Stadt. War sicher aufregend für Stephen King, zum einen wegen des formalen Experiments. Er erzählt eine Geschichte in zwölf an den Kalendermonaten orientierten Kapiteln (jeweils illustriert von Comic-Legende Bernie Wrightson, verstorben 2017). Zum anderen, weil King sich mit dem Werwolf nach den Vampiren von „Salem’s Lot“ von 1975 wieder einem klassischen Monster widmet, dem er neue Nuancen entlocken will.
Schnell erzählt, humorvoll und effektiv, enthält das 127-Seiten-dünne Buch die nötigen Ingredienzien (Silberkugeln gegen Lykanthropen). Die Pointe funktioniert: Der Held ist ein Junge im Rollstuhl und das Tier ausgerechnet ein Pastor, der nichts von seinen Blackouts und anschließender Verwandlung bei Vollmond ahnt, und stattdessen jeden Sonntag weiter predigt.
Es zeigt auch, dass Glaube und Religion uns nicht vor unseren inneren Trieben schützen können. Und: Die Kurzform liegt King einfach.
52. The Colorado Kid (2005, deutsch: „Colorado Kid“) ★ ★ ★

Stephen King: die besten Bücher – Plätze 60 bis 51. 184 Seiten, veröffentlicht im gerade mal ein Jahr alten Verlag „Hard Case Crime“. Stephen King wollte hier vielleicht nicht nur einen etwas kleineren literarischen Versuch starten, sondern auch einer neuen Produktionsstätte unter die Arme greifen. King reihte sich in eine Reihe von Genre-Autoren ein, passenderweise mit der Buchnummer 013, zwischen einem Autoren namens Peter Pavia (012) und dem Veteranen Lawrence Block (014).
Die Erzählung ist weniger wichtig für King, weil er einen Kriminalroman verfasst hat – dem Genre hatte er sich zumindest schon in Kurzgeschichten zugewandt. Es ist das Ende, das begeistert. Der Fall bleibt ungeklärt, obwohl die zwei Kleinstadt-Reporter sich dem Verbrechen nach 25 Jahren ein weiteres Mal nähern. Eine moderne Annäherung an die moderne Art Geschichten zu erzählen.
Die Ruhe und der Witz, mit der die gealterten Dave Bowie (eine mögliche Anspielung auf den Musiker David Bowie wird nicht erklärt) und Vince Teague ihrer jungen Nachwuchsreporterin die Ungereimtheiten schildern, das ist es, was den „Colorado Kid“ zu einem kleinen Vergnügen macht. Sie geben kleine Weisheiten an die nächste Generation weiter, tun ihre Abneigung gegen das Internet kund. Die Neugierde Stephanie McCanns wiederum weckt die Lebensgeister der Oldies.
„Mord ist ihr Hobby“
An der Küste Maines wird 1980 ein Mann angespült, dessen Identität sich zunächst nicht bestimmen lässt. King stattet den „Colorado Kid“ getauften Unbekannten mit Details aus, die den Ermittlern noch mehr Kopfzerbrechen bereiten. Warum hatte er eine russische Münze dabei, wieso Zigaretten, da er doch Nichtraucher war? Spurensucher unter den Lesern unterstellten King einen Recherche-Fehler, was Starbuck’s im Jahr 1980 angeht – er selbst sprach später davon, dass solche Fährten bewusst gelegt worden seien, da er eine Verbindung dieses Romans zu seinen anderen Universen, etwa dem des „Dunklen Turms“, legen wollte. Es wäre reizvoll, stamme der Unbekannte nicht aus unserer Zeit.
Jungreporterin Stephanie erkennt, dass dieser Verbrechensfall dann doch etwas anderes ist als eine typische Episode aus „Mord ist ihr Hobby“. Teague und Bowe machen sich über solche Ermittler lustig. Nicht zuletzt ist „Colorado Kid“ auch ein Plädoyer für die Bewahrung des Unerklärlichen. Geheimnisse nicht zu entschlüsseln, sondern sie bewusst in der Welt, am Leben zu halten. Es sind die alten Journalisten, die ihre Story gar nicht aus der Hand geben möchten, nicht an die großen Zeitungen vermitteln, die immer nur mit dem Mysterium aufmachen – „Fragen, die sich als Nachrichten tarnen. Wo ist Osama bin Laden? Wir wissen es nicht.“
Vielleicht behalten Tote, vielleicht auch Ermordete, eine Würde, wenn ihre Todesumstände nicht geklärt werden?
51. Nightmares & Dreamscapes (1993, deutsch: „Alpträume“) ★ ★ ★

Stephen King: die besten Bücher – Plätze 60 bis 51. Die 24 Stories umfassen Kings bislang größte Arbeitsspanne, von 1971 („Brooklyn August“) bis 1992 („You Know They Got a Hell of a Band“). Der zeitliche Umfang gab ihm auch die Möglichkeit, in den Geschichten eine Vielzahl von Verweisen auf andere seiner Werke einzubauen. Es gibt Verknüpfungen zu „Der Nebel“, „Dolores Claiborne“ oder „Needful Things“ (die für das Verständnis jedoch nicht notwendig sind). Das Audiobook präsentierte seine bislang prominenteste Mannschaft, zu ihr gehörte Jerry Garcia, David Cronenberg, Tim Curry und Stephen King selbst.
Im Epilog wütet King wieder einmal über „die Intellektuellen“, die in ihm einen „Schundschreiber“ sehen – und holt auch wieder einmal die Leser ins Boot, die er als eigentliche Adressaten der Kritik an seiner Person sieht, sind sie es doch, die ihn reich gemacht haben.
Für ihn ist „Nightmares & Dreamscapes“ der abschließende Teil einer Story-Trilogie, die mit „Night Shift“ 1978 ihren Anfang nahm und 1985 zu „Skeleton Crew“ führte. Die Sammlung ist zwar nicht ganz so hochklassig wie die beiden Vorgänger. Einiges taugt eher als Skizze.
„Die Zehn-Uhr-Leute“ hat zu große Ähnlichkeit mit John Carpenters Infiltrations-Horror „They Live“. „Der Nachtflieger“ ist ein eher launisches Spiel mit der Frage, wie Vampire sich heutige Technik für den Beutefang zunutze machen könnten – die Idee ist interessanter als die Geschichte. „Popsy“ verläuft als Papa-wird-schon-kommen-Humoreske absehbar.
6 Höhepunkte
Sechs Geschichten stechen heraus. „Dolans Cadillac“ natürlich, eine Rächerstory, zu der man „Hell Yeah!“-artig die Hände in die Luft werfen will. Mit „Hausentbindung“ veröffentlichte King 1989 seine erste richtige Zombie-Geschichte, ein vor 30 Jahren totgeglaubtes Genre erweckt er wieder zum Leben. Die Perspektive auf die Apokalypse beginnt global, wie es sich für Katastrophengeschichten gehört. Später fokussiert er auf eine Hochschwangere, die einen letzten Besuch von ihrem zurückgekehrten Ehemann erhält. Einer alter Mensch geht, ein neuer Mensch kommt: Hausentbindung.
Das Paar landet in einer verwunschenen Stadt
„Verdammt gute Band haben die hier“ ist eine fabelhafte Groteske, eine Parodie des Fan-Kults, eine zynische Umsetzung des Wunsch, Lieblingsmusiker würden ewig leben – und wie wenig zu Ende gedacht dann diese irrsinnige Hoffnung doch ist. „Sie sagen, da draußen im Hinterland wäre es wunderschön“, sagte er zu ihr, bevor sie sich im Wald verfahren. „Eine der Grundregeln beim Reisen in den Vereinigten Staaten ist, dass Straßen, bei denen nicht auf mindestens einer Seite Leitungsmasten stehen, nirgendwo hinführen.“
Wie wahr: Das Paar landet in einer verwunschenen Stadt, in der alle toten Musiker-Idole, Elvis, Morrison (der Lizard-King lungert als Billardhallen-Bösewicht herum), Hendrix, nicht nur leben, wie sie es sonst nur in Träumen tun. Die versklavte Bevölkerung muss sogar bis an ihr Lebensende Konzerte dieser wandelnden Leichen ertragen und wird zu Begeisterungsstürmen gezwungen. Das klassische Märchen-Motiv, Verirren im Wald, führt direkt in die „Rock and Roll“-Hölle.
Es gibt drei weitere große Stories: „Mein hübsches Pony“, eine Reflektion über das Altern, und wie wir ungewollt dem Tod entgegenstreben. King hat in ihr einen seiner schönsten Sätze eingeflochten: „Wenn Du in ein bestimmtes Alter kommst, so um die 14 glaube ich, wenn die beiden Hälften der Menschheit den Fehler machen, einander zu entdecken, dann fängt die Zeit an, wirkliche Zeit zu sein. Die echte wirkliche Zeit. Sie ist nie so lang, wie sie war, oder so kurz, wie sie sein wird (…). Aber für den größten Teil deines Lebens ist sie die echte wirkliche Zeit.“
„Der Fall des Doktors“
„Crouch End“ ist eine Geschichte, die wohl nur entstehen kann, wenn King gezwungen wird nach Europa zu reisen. Es regnete in London, und er fand kein Taxi, das ihn zu seinem Schriftsteller-Freund Peter Straub bringen könnte. Inspiriert von H.P. Lovecraft erzählt er die Geschichte eines Touristen-Paars, das sich in Crouch End verläuft und verliert, und dabei in eine andere Dimension einzutreten scheint. Ein Junge mit einer Klaue, Motorradfahrer mit Rattenköpfen. Eine Hecke – natürlich, wir sind in England – scheint das Portal zu sein. Es gibt Schilder, auf denen Dinge in fremder Sprache stehen: „Nrtesin Nyarlahotep“, die Sprache Ctulhus.
„Der Fall des Doktors“ machte King sich wohl zur sportlichen Aufgabe. Er wurde im Jahr der Erstveröffentlichung, 1987, 40 Jahre alt. Da musste ein Beweis her, dass er es mit den Göttern aufnehmen kann, und sei es durch Forterzählung. Er versuchte sich am Großmeister Sir Arthur Conan Doyle und schrieb eine Sherlock-Holmes-Geschichte. Wie gewohnt aus der Sicht Dr. Watsons berichtet, wird der Gehilfe hier zu demjenigen, der den Fall dann löst.
Stephen King hat in der Geschichte, die er als seriöse Hommage versteht, einen Fehler gemacht, darauf weist auch die Datenbank „KingWiki“ hin. Er behauptet, dass Holmes der Ausruf „The Game is afoot“, „Das Spiel fängt an“) in den Mund gelegt wurde, obwohl er so nie gesagt worden sei (wie Derricks „Harry, hol schon mal den Wagen“). Das scheint so nicht zu stimmen.
Es gibt Charakterisierungen durch schmeichelnde Sätze („Holmes besaß ein großes Herz. Er schützt es einfach nur besser als die meisten Menschen“), die von Doyle vielleicht nicht verfasst worden wären, aber auch die üblichen Sticheleien: „In Ihnen hat sogar das Feuer der Erkenntnis gebrannt, das Sie, worauf ich wetten möchte, nie wieder entfachen können.“