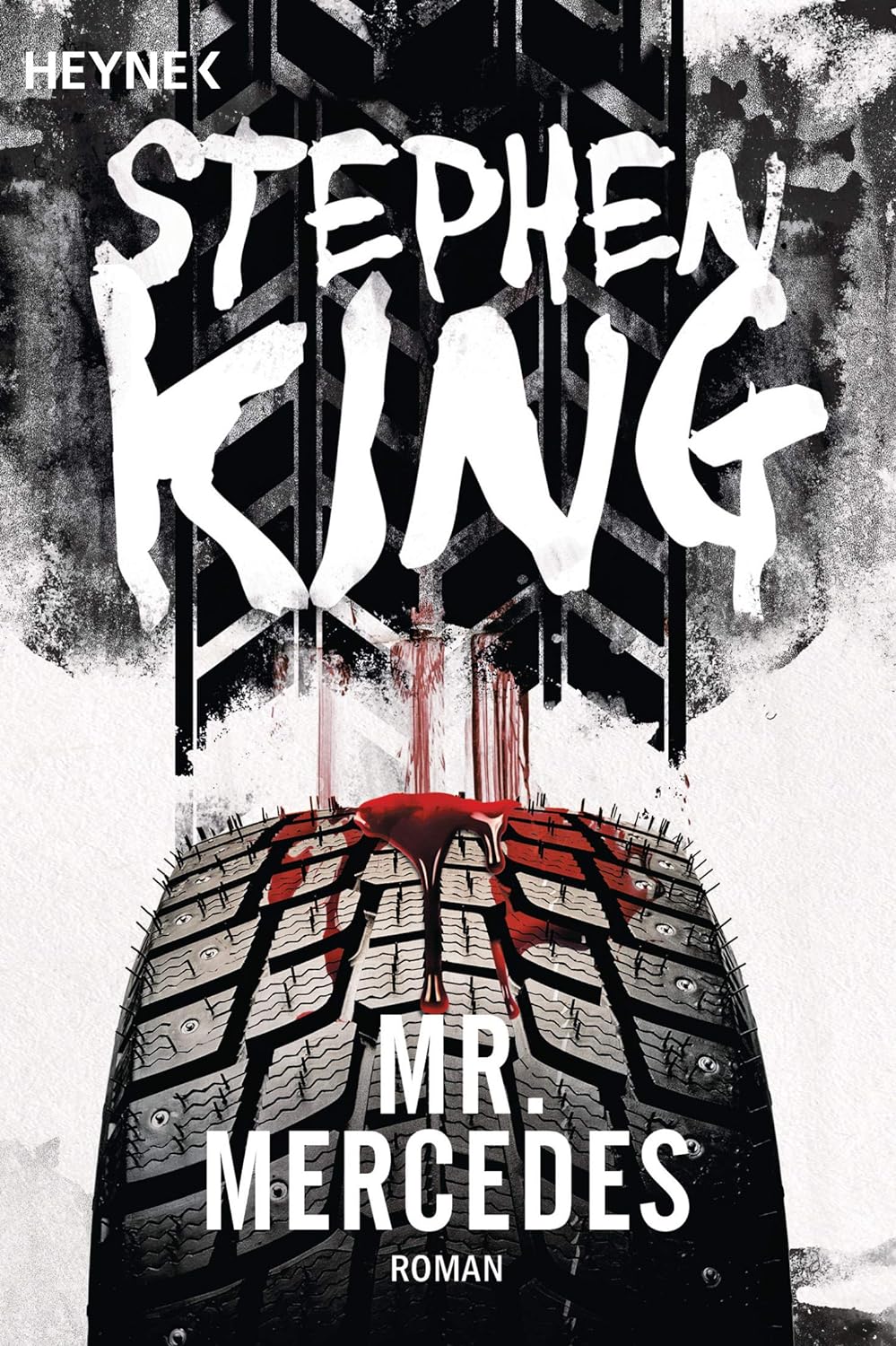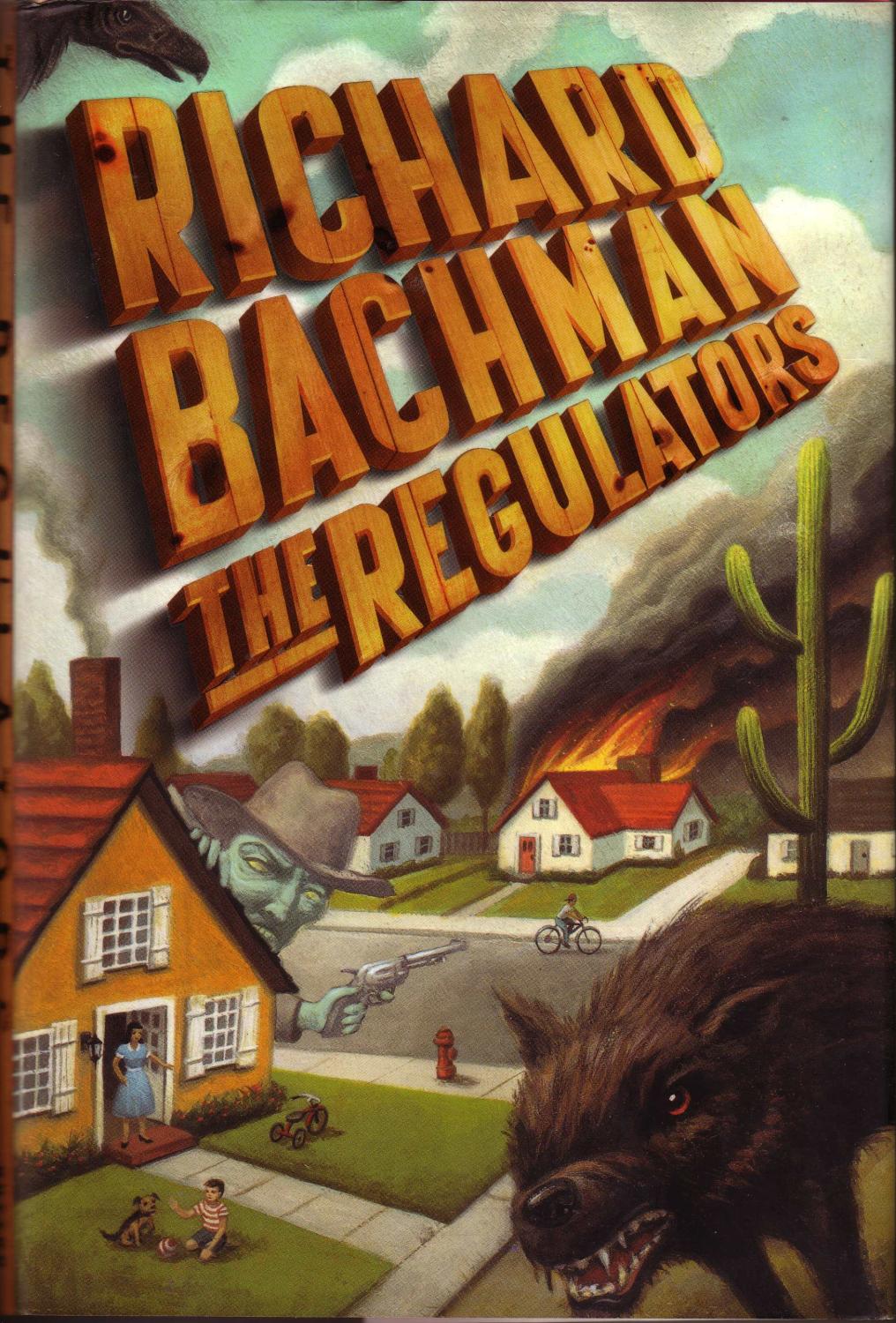Ein Klassiker: Vor 10 Jahren erschien „Mr. Mercedes“ von Stephen King
Kings Geschichte über einen Irren, der ein Auto als Mordwerkzeug benutzt, ist aktuell geblieben
Stephen King – Das Ranking
-
Plätze 81-87
-
Plätze 80-71
-
Plätze 70-61
-
Plätze 60-51
-
Plätze 50-41
-
Plätze 40-31
-
Plätze 30-21
-
Plätze 20-11
-
Plätze 10-01
Ein Mann verübt einen Terroranschlag, indem er mit seinem Mercedes in eine Menschenmenge rast. Sein eigenes Ende plant er, indem er sich auf einem Popkonzert in die Luft sprengt und möglichst viele Kinder und Teenager dazu. Das wirkt nicht weit entfernt. Nizza, der Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Berlin, Ariana Grandes Gig in Manchester – falls er nicht in den Konzertsaal gelangen könne, überlegt sich der Killer, wäre er auch mit dem Atrium der Halle zufrieden.
Die Ereignisse in „Mr. Mercedes“, dem Auftakt der „Bill-Hodges-Trilogie“ von 2014, wurden auf schreckliche Weise von der Wirklichkeit eingeholt. Ob Stephen King mit seinem Tweet, in dem er später die blutige LKW-Fahrt des Attentäters in Frankreich verurteilte, auch Bezug auf seinen Roman nahm? Wer immer Unschuldige töte, schrieb er, der töte auch Menschen, die Teil seiner Familie sein könnten. Wenige seiner Werke sind so aktuell wie dieses hier. Die „Mr. Mercedes“-Serienverfilmung von 2018 hatte sich nicht getraut, das Konzertdrama zu rekonstruieren.
„Auto-Erotik“
Brady Hartsfield ist kein Islamist, auch kein Religiöser, er ärgert sich aber, dass Al-Kaida ihm mit Nine Eleven zuvorkam. Er hat schwammige politische Haltungen, auf jeden Fall ist er ein Rassist. Was andere Zerstörung nennen, nennt er Schöpfung. Den Terror mit er rollenden Waffe nennt er „Autoerotik“.
Der Computer-Hacker wohnt mit Mitte 20 noch bei seiner Mutter und pflegt Mordfantasien, weil er die vermeintliche Dummheit seiner Mitmenschen nicht ertragen kann. Er arbeitet in einem Elektro-Handel sowie als Eismann im Bimmelwagen. Die Bindung zur Mutter ist auch deshalb so zerstörerisch, weil die Alkoholikerin den Sohn sexuell missbraucht.
Hartsfield ist die böse Karikatur des Computer-Nerds, der nur eine einzige Sache besser kann als seine Mitmenschen und deshalb Weltpolizist spielt. Umso überraschter sind Bill Hodges und wir Leser, wie „überraschend gut aussehend“ der Terrorist doch auf einem Familienfoto aussieht – man ertappt sich also bei dem Gedanken, dass so einer die Rache an seinen Mitmenschen gar nicht zu einem Motiv machen müsste, dass er eigentlich jemand ist, der von der Natur beschenkt wurde.
Der Kampf des Cops im Ruhestand gegen den Psychopathen ist auch ein Kampf der Nachrichtensysteme. Der Rentner lernt seinen Rechner zu bedienen, probiert sich in der Anonymität der Mails und Chaträume, um sich ein Fernduell mit dem Gegner zu liefern. Wie ein Kind lernt Bill – mit Hilfe des Nachbarjungen Jerome – die Digitalität kennen. „Ein Computer ist nichts anderes als ein viktorianischer Sekretär voller Geheimfächer“, denkt er. Jerome sagt: „Ihr Computer ist nicht einfach so was wie ein neuartiger Fernseher. Jedes Mal, wenn sie ihn einschalten, öffnen Sie ein Fenster zu ihrem Leben.“
Fast schon einer Komödie gleich, wird der Verdacht früh und mehrfach auf „den Eismann“ gelegt, der Gedanke aber als Unsinn abgetan. Der Eismann als Killer ist wie der Gärtner als Killer: ein Klischee.
„Mr. Mercedes“ streift die Lage unserer Zeit, die Weltwirtschaftskrise, die amerikanische Rezession, den Untergang der Ladenketten in Zeiten des Onlinehandels (Hartsfield arbeit in einem Discounter). Nicht zuletzt gelingt es Stephen King, mit dem selbstironischen, schlagfertigen Jerome einen afroamerikanischen Teenager zu erfinden, wie man ihn vom 70-Jährigen noch nicht kannte, und mit Freddi Linklater eine lesbische Kollegin Hartsfields, die ihren Umgang mit Kunden mit gebührendem Zynismus bewertet – Frauen wie sie haben es in Amerika eh schon schwer genug.
Ist Hartsfield deshalb auch ein Opfer seiner Umstände? So weit geht King nicht. Der „Mercedes-Killer“ bestraft mit seiner Amok-Tour die Hilflosen und Schwachen, die in den frühen Morgenstunden Schlangen vor einer Jobmesse bilden.
Als hätten sie nur darauf gewartet, dass er sie mit dem Wagen niedermäht.