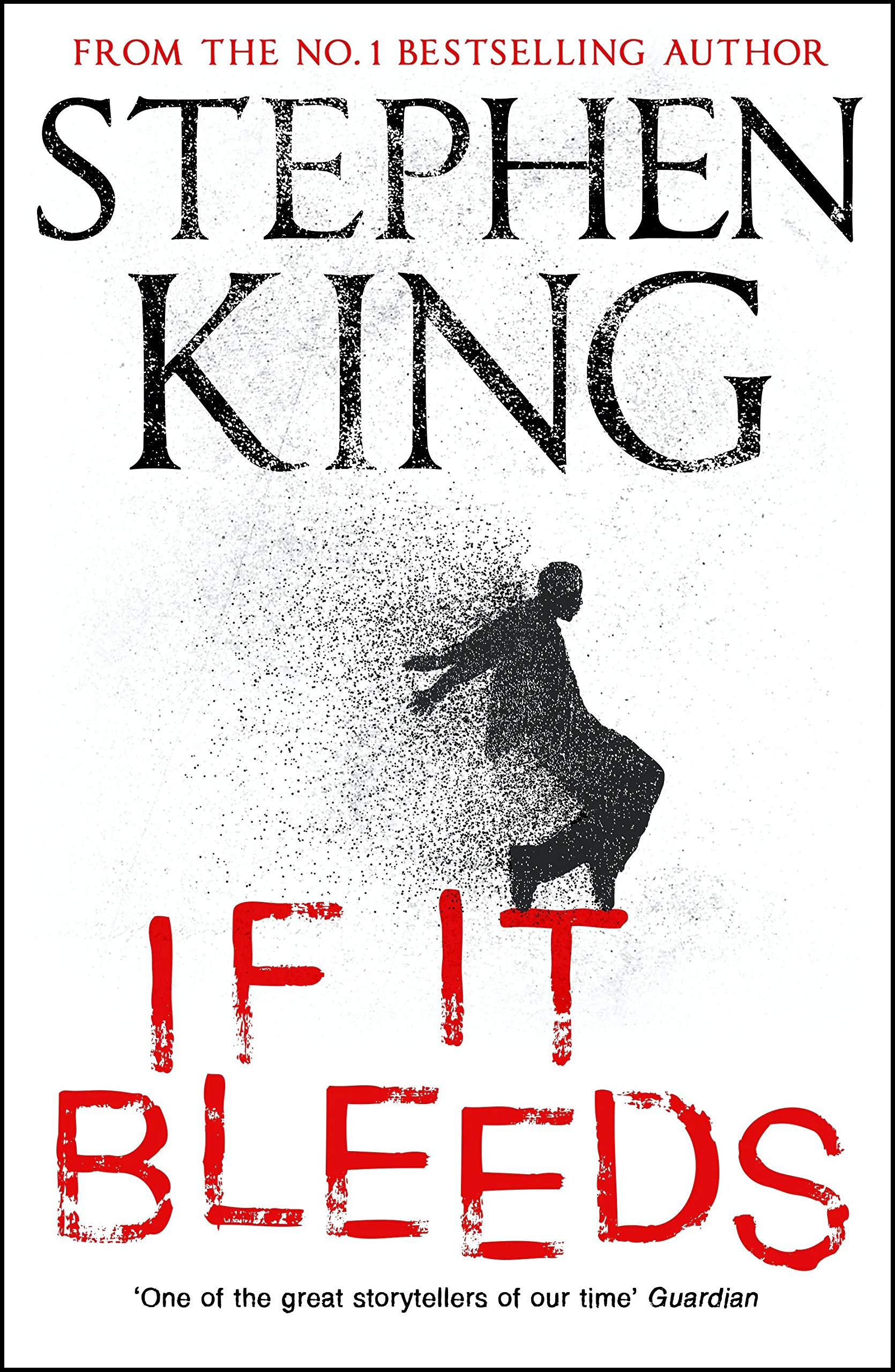Stephen King
If It Bleeds
„If It Bleeds“ vereint vier Novellen, in denen es mal mehr, mal weniger deutlich um Gedanken über die Sterblichkeit geht. Es sind sauber geplottete Storys, aber sie fügen seinem Oeuvre nichts Neues hinzu, sie sind Variationen.
Die besten Bücher von Stephen King:
-
Plätze 81-71
-
Plätze 70-61
-
Plätze 60-51
-
Plätze 50-41
-
Plätze 40-31
-
Plätze 30-21
-
Plätze 20-11
-
Plätze 10-01
If It Bleeds (2020, deutsch: „Blutige Nachrichten“)
Mit „Revival“ und „Mr. Mercedes“ liegen die letzten wirklich bedeutenden Romane Stephen Kings sechs Jahre zurück, und das schöne, aber sehr schmale „Elevation“ von 2019 wirkte eher wie eine Fingerübung, ein flüchtiger Gedanke zum Leben nach dem Tod, wenn es denn eines gibt; Stephen King ist in diesem Jahr 73 geworden.
„If It Bleeds“ vereint nun vier Novellen, in denen es mal mehr, mal weniger deutlich um Gedanken über die Sterblichkeit geht. Es sind sauber geplottete Storys, aber sie fügen seinem Oeuvre nichts Neues hinzu, sie sind Variationen. „Mr. Harrigan’s Phone“ behandelt ein King‘sches Herzensthema, die Verzweiflung gegenüber immer moderner werdender Kommunikationstechnik, unter der schon sein früherer Privatdetektiv Bill Hodges auf der Suche nach dem Mercedes-Killer litt. „Ich will mit leeren Taschen begraben werden“, verkündet der Teenager Craig, der glaubt, über einen Anruf beim Mobiltelefon seines verstorbenen Mentors Wünsche erfüllt zu bekommen – und es bald als Fluch sieht. Für ihn ist die Telekommunikation buchstäblich ein Geist in der Maschine, die Handys das, was uns heute mit der Welt verbindet.
„The Life Of Chuck“ ist die komplizierteste, träumerischste und schönste Geschichte des Buchs. Es geht um das, was mit dem Tod eines Menschen einhergeht: Nicht nur der Verlust eines Menschen, sondern eines ganzen Gedankenuniversums, in dem sich etliche Geschichten mit unzähligen Protagonisten befinden, bei denen allesamt unwiderruflich das Licht ausgeknipst wird. „Wie kommst Du überhaupt auf die Idee, Du wärst die Hauptfigur in irgendwas anderem als Deinem eigenen Kopf?“, will einer wissen.
Vielleicht sorgt Stephen King, die eigene Vergänglichkeit vor Augen, sich in solchen Momenten auch um sein eigenes Erbe: Was geschieht mit den Storys in mir, wenn ich irgendwann mal nicht mehr bin? Er führt die Figur des Chuck ein, ein Bürohengst des weißen Amerikas, der fleißig immer mehr Geld scheffelte und sich erst auf dem Totenbett wieder daran erinnert, dass er einst ein junger Mann war, einer der lebte und auf der Straße tanzte.
„Rat“ behandelt die Angst vor dem weißen Blatt Papier und die Frage, was ein Schriftsteller zu tun bereit wäre, um einmal im Leben ein bedeutendes Werk zu veröffentlichen. Welche Opfer gebracht werden müssen, um in jenen Zustand einer selektiven Wahrnehmung zu gelangen, in dem nur noch das Buch und nichts anderes wichtig ist. Interessanter als der faustische Pakt mit der „Ratte“ sind die süffisanten Auslassungen über – geschätzte – Kollegen, das kommt bei King nicht sehr häufig vor. Diesmal steht Jonathan Franzen im Mittelpunkt. Herrliche Zusammenfassung des Lebensthemas dieses großen amerikanischen Schriftstellers, der immer wieder „the great American novel“ (alle benutzen den Begriff – aber was genau ist das eigentlich, der „große amerikanische Roman“?) schreibt: „Akademikerpaare, die Bäumchen-wechsel-dich spielen, zu viel Alkohol trinken und in die Midlifekrise rutschen.“ Vielleicht hören Franzen, oder Richard Ford und Stewart O’Nan ja zu.
Die problematischste Novelle ist das titelgebende „If It Bleeds“. „Ich liebe Holly. So einfach ist das“, schreibt King im Nachwort. Manchmal reicht die Liebe zu einer Figur aber nicht, um für sie eine gute Geschichte zu konstruieren. Es ist der fünfte Romanauftritt der neurotischen Privatdetektivin Holly Gibney, das macht sie – von den Charakteren der „Dunkler Turm“-Reihe abgesehen – zur meistgenutzten im Schaffen des Autors, der bald auf die 100 Bücher zugeht. Gibney ist auch die Einzige, die aus einer Trilogie („Hardboiled“-Trilogie) herausgetreten ist. Nach dem „Outsider“ (2018) jagt sie erneut einen „Outsider“, deren simpler Plot – sie erkennt ihn, sie ruft ihn an, sie konfrontiert ihn – nicht für einen Roman gereicht haben kann, das hat King korrekt erkannt. Umso leidenschaftlicher stürzt er sich auf die Psychogenese der Figur, die sich am Ende, nach dem Sieg über die Beste, attestiert, „normal“ zu sein.
Natürlich sind wir das – wir sind alle „normal“. Wer kann das Gegenteil beweisen?