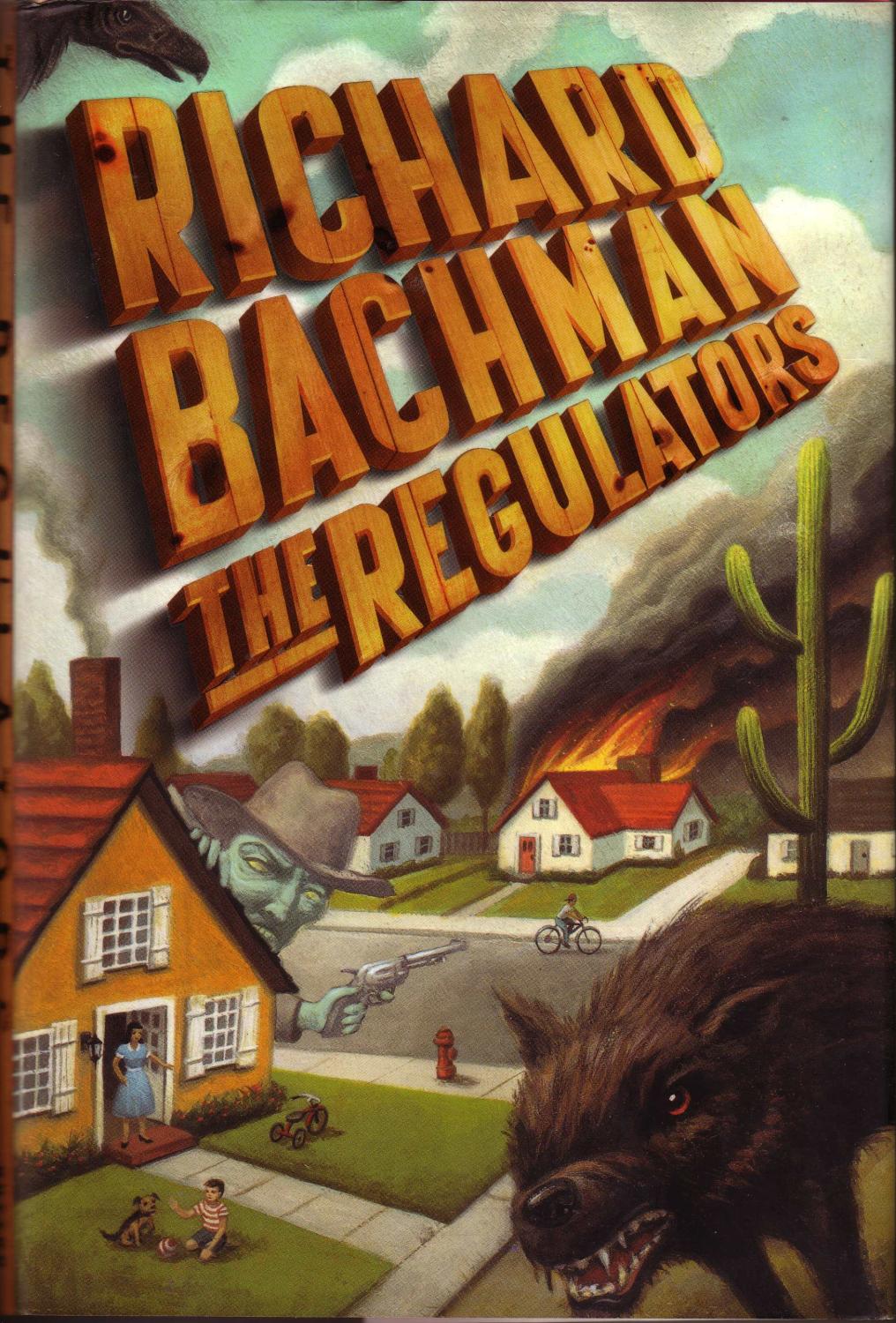Kritik: Stephen Kings „Holly“ – ein gut gemeinter Roman, der Trump wohl leider egal sein wird
Ob sich das King-Buch lohnt, lesen Sie hier
Stephen King – Das Ranking
-
Plätze 81-87
-
Plätze 80-71
-
Plätze 70-61
-
Plätze 60-51
-
Plätze 50-41
-
Plätze 40-31
-
Plätze 30-21
-
Plätze 20-11
-
Plätze 10-01
Ob Donald Trump seinem scharfen Kritiker Stephen King jemals antworten wird? Seit 2016 arbeitet sich der „Meister des Horrors“ am Ex-Präsidenten ab, dem Ork mit der orangefarbenen Haut und der erdbeerfarbenen Frisur (von der Existenz dieser Haartönung wissen wir auch erst seit dem Mugshot-Steckbrief), ohne dass der ihm auch nur ein einzelnes Mal eine Replik geschenkt hätte.
Ob im „Institut“, in „Billy Summers“ oder „If It bleeds“, King hat sich derart auf Trump eingeschossen, dass es nicht bei spitzen Verweisen auf dessen desaströse Politik und seinen anhaltenden schädlichen Einfluss auf die Welt bleibt, sondern Analogien zum ehemaligen POTUS fast schon den Handlungsrahmen der King-Storys bilden. Man freut sich mittlerweile schon auf mittelmäßige Bücher wie „Fairy Tale“, weil sie in einer (Fantasy-)Welt spielen, in der The Donald nicht vorkommen könnte.
Womöglich fühlt King, Jahrgang 1947 und damit nur ein Jahr jünger als Trump, sich dauerbeflügelt, weil er mit „The Dead Zone“ von 1983 und „Under the Dome“ von 2009 zum Propheten wurde: Die Romane handeln von Machtmenschen mit Trumpschem Größenwahn. Präsidentschaftskandidat Greg Stillson und Stadtrat Jim Rennie tragen Trumps Wesenszüge, und er trägt ihre.
Jede Kritik an Donald Trump ist berechtigt, nur leidet Kings neuer Roman „Holly“ unter dieser Fixierung wie kein Roman davor. Es macht King, den erfolgreichsten Schriftsteller der Welt, auch ein wenig uncool. Trump-Wähler, MAGA-Rotkäppis, Querdenker, Verschwörungstheoretiker, Impfverweigerer – King liefert die Zustandsbeschreibung einer USA, die komplett irre geworden zu sein scheint. Die Leute, die den eher linkspolitischen King (der bis Ende der 1960er-Jahre noch ein Republikaner war) nicht lesen, wird er nie erreichen. Für alle anderen, seine Leute, gilt: he’s preaching to the choir.
King hat außerdem ein Händchen für äußerst problematische Darstellungen von Frauenfiguren. Stets verteidigt er das Prinzip der selbstbestimmten Entwicklung seiner Heldinnen – und merkt anscheinend nicht, dass er sie alle erst durch einen Mentor eine gewisse geistige Reife sowie Schlagkräftigkeit erreichen lässt, nicht etwa durch die – Achtung, Modewort – „Selbstermächtigung“. Ohne den mittlerweile verstorbenen, älteren Detektiv Bill Hodges jedenfalls wäre Romanheldin Holly Gibney nicht die geworden, die sie heute ist.
Es ist äußerst unangenehm zu lesen, wie King die Mittvierzigerin Holly Gibney, eine Neurotikerin mit Zwangsstörungen, verniedlicht
King liebt seine Holly. Im reichen, auf die 100 Bücher zustrebenden King-Output nimmt die Ermittlerin eine Spitzenposition ein: Hauptcharakter in zwei Romanen, von denen nun einer nach ihr benannt wurde („Holly“, davor war sie in „The Outsider“), Nebenfigur in drei Romanen (die „Bill-Hodges-Trilogie“) sowie Hauptfigur in einer Kurzgeschichte („If It Bleeds“). Abgesehen vom „Dunklen Turm“-Ensemble, das sich aufgrund der episodischen Erzählung in bis zu acht Romanen entfaltet, gibt es niemanden, dem King sich ausgiebiger gewidmet hat.
Es ist äußerst unangenehm zu lesen, wie King die Mittvierzigerin Holly Gibney, eine Neurotikerin mit Zwangsstörungen, verniedlicht. Er verniedlicht viele seiner erwachsenen Frauen. Am schlimmsten die „kleine Lisey“, einer Frau über 50, aus „Lisey’s Story“ – ausgerechnet jener Roman, den er als seinen besten bezeichnet, was einigermaßen tief blicken lässt. Holly findet vieles „bäh“ und nimmt sich selbst bei ihren Bäh-Erlebnissen, ganz Kleinkind, in der dritten Person wahr („Holly hasst Schlangen“). Und wenn sie auf der richtigen Fährte ist, spürt sie sogleich die „Holly-Hoffnung“.
Aber sie ist auch ein Ermittlergenie, das sich in Momenten größter Anspannung nicht aus der Ruhe bringen lässt. Die Neurotikerin Holly als eine Frau mit vermeintlich kühlem Kopf gegen Coronaleugner antreten zu lassen, erscheint zunächst gewagt, wie eine Selbstentwaffnung. Allerdings sind Hollys auf Recherchereise getroffenen Schutzmaßnahmen – Masken, Desinfektionsmittel – in einem vom Lockdown aufgewühlten Land und im Kontakt mit den unzähligen, an alternative „Wahrheiten“ glaubenden Mitmenschen eben auch vernünftig.
Sind die Manierismen aus dem Lexikon der Verhaltensauffälligkeiten gerade noch akzeptabel, werden die Anti-Trump-Suaden nahezu in Listicle-Form dargeboten, denn es muss ja Platz für alles bleiben, was seit 2016 passiert ist: „Tränen der Erleichterung“, als Biden die Wahl gewonnen hat, „Tränen des Zorns“ beim Sturm auf das Kapitol und der „Diebstahl“ der Wahl durch die Demokraten; der Coronatod von Hollys Mutter, einer impfunwilligen Trump-Anhängerin; die Frage, ob der Virus in einem Labor in Wuhan entstanden ist; NRA-Anhänger, die Töchter verstoßen, weil die ihre durch Vergewaltigung gezeugten Föten abgetrieben haben; Freisprüche für Weiße Polizisten, die einen Schwarzen Teenager mit defektem Autorücklicht bei einer Verkehrskontrolle erschießen; den Staatsdienst quittierende Beamte, die der „Corona-Diktatur“ nicht folgen wollen und deren Verlust dann schmerzlich registriert wird, wenn nicht mehr genug von ihnen da sind, um die Protestierenden der Black-Lives-Matter-Bewegung vor fanatischen Gegendemonstranten zu schützen.
Hinter dem Polit-Rant verbirgt sich eine bemerkenswerte Geschichte über wahre Monster: Verschwörungstheoretiker, die zu Kannibalen werden. Sie glauben, durch den Verzehr von Menschen den Alterungsprozess aufheben zu können. „Holly“ ist nach „Billy Summers“ von 2021 ein weiterer Roman, in dem der Schrecken nicht übernatürlichen Ursprungs ist.
Die Realität Amerikas scheint King mittlerweile ein größeres Grauen zu sein. Bedauerlich, dass er das auf den letzten Seiten selbst betonen muss, nicht mit Hollys, sondern seiner eigenen Erzählstimme: Jenes geriatrische, auf Opfersuche gehende Professorenpaar, das durch Verzehr von Menschenfleisch auf Verjüngungseffekte hofft, aber auf einen Placebo-Effekt hereinfällt, sei schlimmer als die Kreaturen aus dem Jenseits, denen Holly sich zuvor stellen musste – den „Outsidern“, die Gestaltwandler Terry Maitland und Chet Ondowsky.
King ordnet hier selbst sein eigenes, neues Werk als singulär ein. Als würde er uns nicht zutrauen, diese Schlussfolgerung selbst zu ziehen, sofern wir ihm die Besonderheit dieser vorliegenden Erzählung zugestehen. Genauso muss er zweimal aufschreiben, was uns selbst als verblüffende Erkenntnis gekommen ist: Eine im Käfig gefangene Frau kann aus dem Käfig heraus zwei Menschen töten.
Per Van und Rollstuhl gehen die Alt-Akademiker Emily und Rodney Harris in „Holly“ auf Beutefang. Doch die von King nachträglich verharmlosten „Outsider“ erscheinen doch etwas agiler als das keifende Rentnerduo, dem King eine Tea-Party-Mindset-Vollausstattung verpasst: Sie sind Nixon-Verehrer, Trump-Bewunderer („ein Zauberer mit Abrakadabra“), Fauci-Feinde und, was sich bei Tea-Party-Anhängern natürlich nicht generalisieren lässt, Rassisten.
Was vielleicht ein bisschen zu viel ist, um aus Feindprojektionen glaubhaft wirkende Charaktere zu machen. Mit Argumenten kann man dem Ehepaar Harris jedenfalls nicht kommen – fragen die beiden sich eigentlich, ob man sich durch den Verzehr rohen Menschenfleischs nicht auch mit Covid anstecken kann? –, und es ist zumindest eine gelungene Pointe, dass Holly die beiden buchstäblich zu fassen kriegen wird, als die mit ihrem Gefasel aufhören und sich ihr bis auf wenige Zentimeter nähern, also ungewollt in den 1:1-Combat gehen.
Hollys Recherchen zu den Entführungsopfern werden durch die Coronapolitik erschwert. Das ermöglicht zumindest immer dann stärkere Passagen, wenn King den Hinterbliebenen der Verschwundenen keine Reden in den Mund legt, die wie Statements des Autors wirken: Rettungsdienste kommen nicht durch, weil das Personal erkrankt ist, oder sie kommen gar nicht erst, da das Personal sich in den Hospitälern um Erkrankte kümmern muss; und die Flure der Hospitäler sind überfüllt.
„Töte deine Lieblinge!“ lautete Kings früheres Motto. Heute heißt es: Lasst meine Lieblinge in Ruhe!
Hollys Gemeinde hat sich in den mittlerweile sechs Erzählungen stark verfestigt, Pete Huntley ist noch da, auch das Geschwisterpärchen Jerome und Barbara Robinson. Der späte Stephen King ist ein gnädiger, er lässt die meisten seiner Protagonisten mittlerweile am Leben, womöglich hätte die tödliche Opferung einer Hauptfigur jedoch der einen oder anderen Erzählung der vergangenen 20 Jahre, auf jeden Fall dieser, gutgetan.
„Töte deine Lieblinge!“ lautete Kings früheres Motto. Heute heißt es: Lasst meine Lieblinge in Ruhe! Den jungen Barbara und Jerome steht eine große Karriere als Autoren bevor, die lyrisch hochbegabte Barbara wird in den Rang einer Amanda Gorman erhoben (King selbst zieht den Vergleich, er drängt sich aber schon sehr früh auf), darf sich auf einen TV-Auftritt bei natürlich Oprah Winfrey freuen – über die Frage „transzendiert Lyrik Rassismus?“ muss sie dann aber doch nachdenken. Ein weiteres Feld, das King wacker beackert.
Streng genommen hätte King sowohl auf Barbara als auch Jerome für diese Erzählung verzichten können, beide sind für die Entwicklung der Ereignisse nicht wirklich relevant – nur die Befreiung Hollys am Ende hätte er neu denken müssen. Barbaras Funktion als Retterin in letzter Not besteht darin, auf Hollys dringliche Bitte hin den Revolver abzulegen, mit dem sie das fremde Haus, in dem ihre Freundin gefangen gehalten wird, betritt. Holly befürchtet, Barbara könnte von der sogleich alarmierten Polizei als Einbrecherin wahrgenommen, und, weil, sie Schwarze ist, erschossen werden.
Stephen King liebt die Bill-Hodges-Gang; sollte er im Jahr 2024 tatsächlich mit „We think not“ den nächsten Holly-Roman veröffentlichen, die siebte Holly-Story in zehn Jahren, werden dann auch Jeromes und Barbaras Abenteuer weitergesponnen?
King ist, auch mit bald 76 Jahren, der wahrscheinlich betriebsamste Schriftsteller-Millionär (oder ist er schon Milliardär?), der je auf Erden wandelte. Seine Veröffentlichungsquote beträgt aktuell Pi mal Daumen 1,4 Bücher pro Jahr; sein Spitzenwert in den 1980er- bis Nullerjahren betrug drei pro Jahr. Wahrscheinlich ist er auch der verdienteste Super-Schriftsteller, denn er arbeitet derart viel, dass er sein Geld niemals für Weltreisen oder Yachten ausgeben könnte, dafür hat er keine Zeit.
Als er sich 2013 für die „Doctor Sleep“-Lesung nach Europa bemühte, war das eine Sensation. Das Einzige, was King bleibt, worauf er Lust hat, ist Maine im Sommer und das wärmere Florida im Winter. Dort kann er sich über den – von ihm verehrten – Nachbarn Thomas Harris aufregen, weil der in 48 Jahren nur sechs Romane geschafft hat.
King scheint sich auch mit 76 bester Gesundheit zu erfreuen, nicht selbstverständlich, er war in den 1970er- bis 1980er-Jahren über einen Zeitraum von zehn Jahren stark kokain- und alkoholabhängig. Irgendwann berichtete er auch mal, langsam zu erblinden, das muss aber mindestens 15 Jahre her sein. Anscheinend kann er mittlerweile blind schreiben. Es darf jedoch auch die vorsichtige Frage erlaubt sein, ob sich die Mehrheit seiner Leser wirklich wünscht, dass King in dieser Phase seines Lebens für die nächsten Jahre plant, weiterhin vorrangig Oden an seine Holly zu publizieren.
Jemand sollte mal eine valide Umfrage erheben: Wie beliebt ist Holly Gibney eigentlich unter Stephen-King-Lesern? Das Ergebnis könnte den Meister vielleicht überraschen. Gibt es möglicherweise andere Charaktere, die man nicht nur in einer oder zwei, stattdessen gerne in sechs – bald sieben – Erzählungen begleiten würde?
Danny Torrance vielleicht, Jack Sawyer, Charlie McGee oder Devin Jones? Ben Mears, das wär’s doch! Und was wird King bloß tun, sollte Holly Gibney irgendwann ein beschwerdefreies Leben führen? Wahrscheinlich würde er genau das nicht zulassen. Aber die Holly-Hoffnung stirbt zuletzt. Bäh?