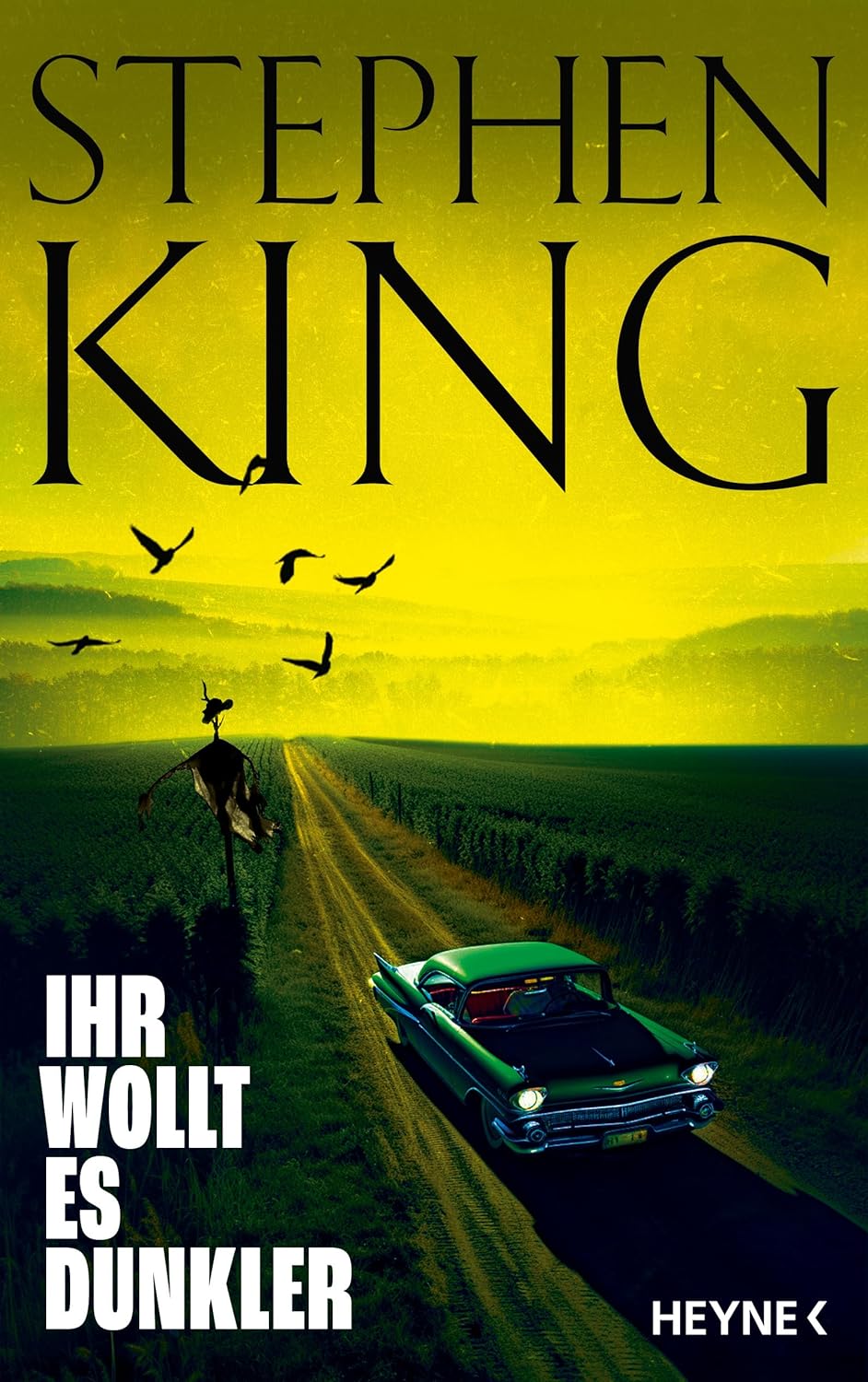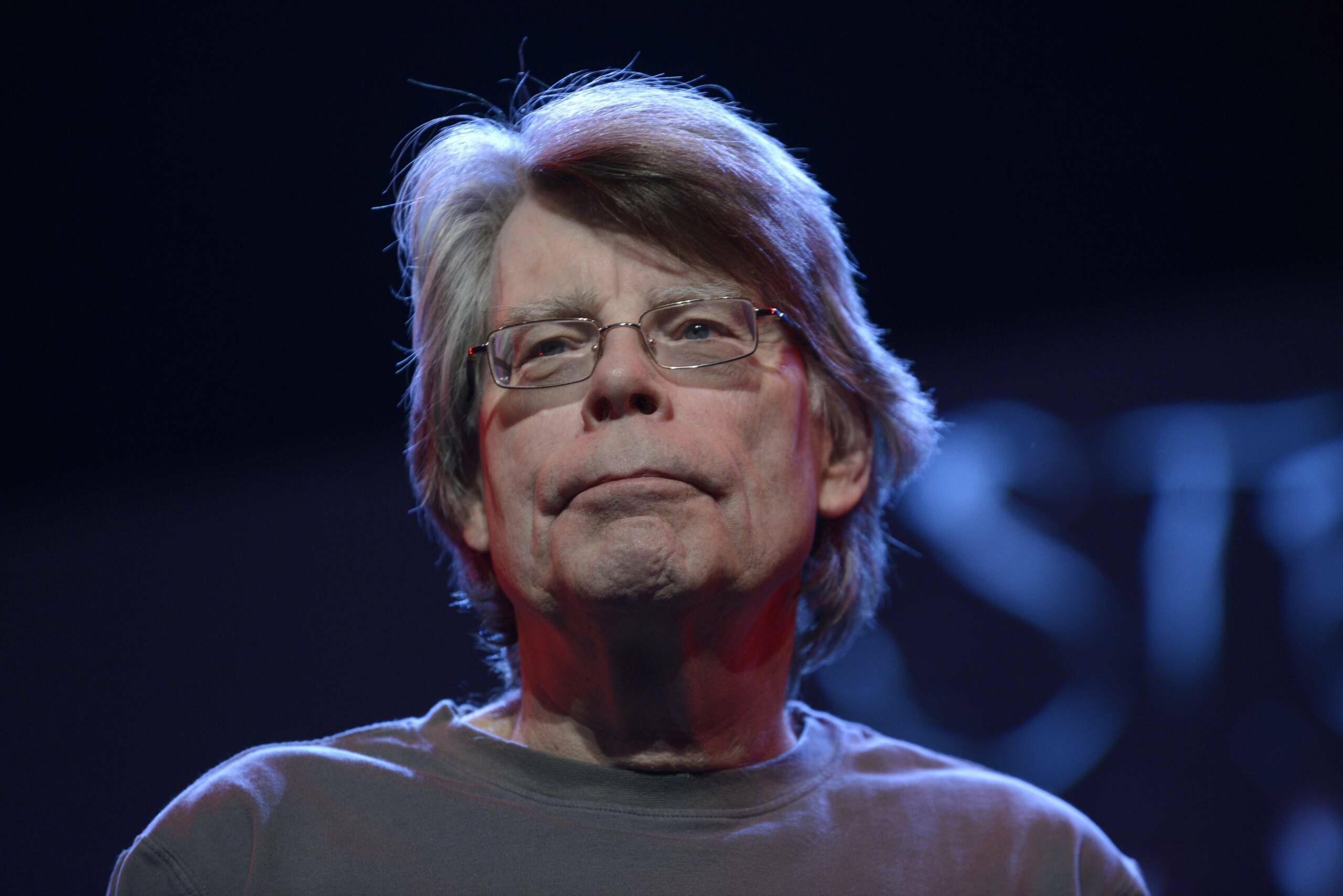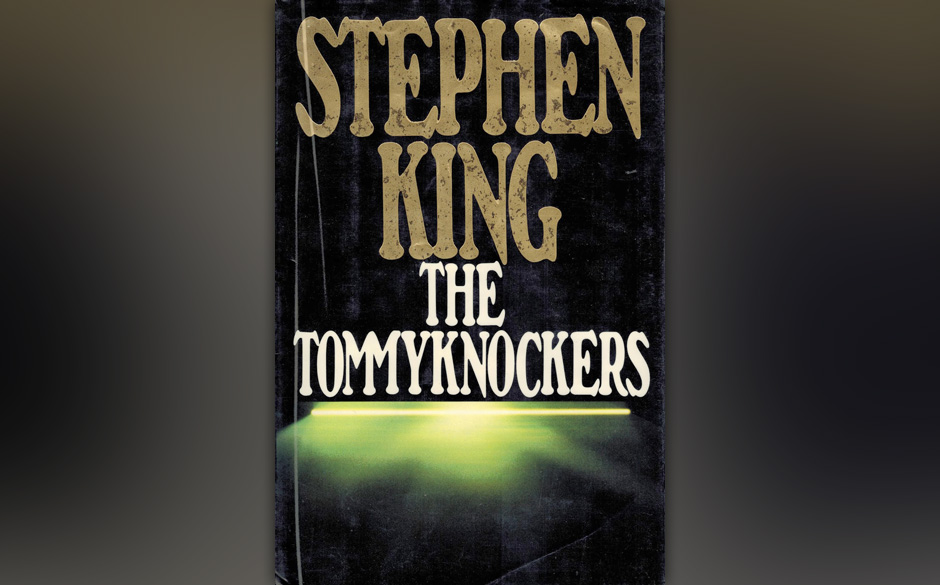Kündigt Stephen King mit „Ihr wollt es dunkler“ seinen langsamen Abschied an?
Hervorragende Geschichten über das Älterwerden und geplatzte Träume.
Stephen King – Das Ranking
-
Plätze 81-88
-
Plätze 80-71
-
Plätze 70-61
-
Plätze 60-51
-
Plätze 50-41
-
Plätze 40-31
-
Plätze 30-21
-
Plätze 20-11
-
Plätze 10-01
Streng genommen müsste die neue Kurzgeschichtensammlung Stephen Kings nicht „Ihr wollt es dunkler“, sondern „Ihr mögt es dunkler“ heißen. Schließlich weist King im Nachwort selbst darauf hin, dass er seinen Buchtitel „You Like It Darker“ an Leonard Cohens „You Want It Darker“ angelehnt hat – was wiederum sein deutscher Verlag Eins zu Eins so umgesetzt hat. Im Deutschen also die volle Cohen-Reminiszenz.
Sei’s drum. In den vergangenen zehn Jahren hat King 17 Bücher (Kurzgeschichtensammlungen, Romane, ein Kinderbuch) veröffentlicht, aber nur vier davon, die sehr gut sind: die leider prophetische Terroristen-Erzählung vom „Mr. Mercedes“, die Lovecraft-Hommage „Revival“, die in Buchform gepresste Novelle „Elevation“ so wie die sehr spannende Lee-Child-Hommage „Billy Summers“. Mit „Ihr wollt es dunkler“ hat der bald 78-Jährige eine Sammlung vorgelegt ist, die so gut ist, dass man schon bis 1993 zurückgehen muss, um mit „Nightmares and Dreamscapes“ eine Kollektion ähnlicher Klasse zu finden.
Es sind Geschichten über die Akzeptanz geplatzter Träume und von leisen Abschieden – fast alle seiner Protagonisten in den zwölf Stories (von denen King vier als Novellen gekennzeichnet hat) sind in seinem eigenen Alter, also über 70. Wenn sie jünger sind, wie der 36-jährige Hausmeister Danny Coughlin in „Danny Coughlins böser Traum“, wirken sie trotzdem wie Männer, die sich zu einem letzten Abenteuer aufraffen wollen. In dieser Story träumt jener Coughlin vom Fundort einer Leiche, wird daraufhin selbst zum Tatverdächtigen erklärt und verliert Job, Ansehen und Freunde. Eine Geschichte über Cancel Culture, und wie es nie schaffen kann, daraus als Sieger hervorzugehen; sie erinnert an den „Outsider“-Roman.
Pyramidensystem der Klarheit
Klatsch und Tratsch, schreibt King, sind wie radioaktiver Abfall – haben eine lange und giftige Halbwertszeit. Und der Gossip-Chefreporter, der den Hausmeister bis ins Kleinste niederschreibt, hat eine „hitlerische schwarze Stirnlocke“. Verfolgt wird Coughlin aber vor alllem vom KBI-Ermittler Jalbert, eine besonders gelungene Figur, ein Neurotiker, der seinen Zählzwang wie „ein Pyramidensystem versteht, dessen Dividende nicht in Geld, sondern Klarheit besteht“. Der Mann ist von seienr Mission überzeugt. Ein guter Antagonist, vielleicht sogar ein Antiheld. Corona hat ihn endgültig aus dem Konzept gebracht.
Die Klasse von „Danny Coughlins böser Traum“ zeigt sich in der Überflüssigkeit seiner paranormalen Ausgangssituation. Die Frage, ob Coughlin seine Unschuld beweisen kann, wird viel interessanter als die Frage, warum er überhaupt diese Träume hat, durch die er Morde vorhersehen kann. Seine Träume sind ein McGuffin. Man muss eben doch nicht jedes Wunder erklären, und der Schlusssatz „Es gibt nichts zu sagen“ könnte nicht besser sein.
Geschichte eins allerdings heißt „Zwei begnadete Burschen“, die einen Verweis auf den Klassiker „November Rain“ von Guns N’Roses enthält (aber mal ehrlich, übel ist nicht der Novemberregen, sondern der Dezemberregen – nicht wegen der Temperatur, sondern allein aufgrund der Tatsache, dass jeder im Dezember Schnee, und niemand im Dezember Regen erwartet). Vor allem aber enthält sie einen Besuch von Außerirdischen. Stephen King stellt sich hier der Frage, inwieweit Talent gegeben, inwieweit Talent ausgearbeitet werden muss, und inwieweit es einfach Glück oder Förderung sein kann, ein begnadeter Künstler, oder in seinem eigenen Fall, ein begnadeter Schriftsteller zu werden. Er schreibt auch über Söhne, die das Können ihrer Väter niemals erreichen.
Owen King und „Joe Hill“
Und auch, wenn King in seinem Nachwort seine eigenen zwei Söhne, die wie er Autoren geworden sind, lobt, kommt man nicht drumrum, an Owen King und „Joe Hill“ zu denken. Der Senior würde sie natürlich nie bloßstellen. „Zwei begnadete Burschen“ liest sich auch so, als würde Stephen King zu überirdischen Begründungen für sein Talent zurückgreifen wollen. Hier gibt es einen Sohn, der an seinen Vater nicht heranreicht, und der sich selbst als „Höhlenmensch, der viel grinst, aber nie lächelt“, beschreibt. Und, wenn er dürfte, dennoch nur einen sehr bescheidenen Wunsch hätte. Es ist eine sehr traurige, gelungene Story.
„Der fünfte Schritt“ ist nur acht Seiten lang und hat einen Twist. Stephen King ist eigentlich kein Twist-Autor. Dieser hier ist sehr gut. Man fragt sich, welche Horrorgeschichten er sich während seiner Sitzungen bei den Anonymen Alkoholikern hat anhören müssen.
Nur unwesentlich länger ist „Willie der Wirrkopf“, dessen Charaktere typisch sind für King, der unterschätzte Greis, der auch für schlechte Entwicklung empfangsbereite junge Sonderling, und die beide der Einschätzung Lügen strafen, dass den Jungen die Welt gehört.
„Finn“ spielt – warum auch immer – nicht in den USA, sehr sehr selten bei King, und stellt die am Ende brutale Frage, ob Determinismus eine Konstante in unser aller Leben ist – und alles andere, das Abweichen vom Kurs, nur eine Fantasie in den letzten Sekunden unseres Lebens.
„Auf der Slide Inn Road“, ist, wie einige andere in „Ihr wollt es dunkler“, eine in Publikumszeitschriften veröffentlichte Kurzgeschichte, und als Gedankenspiel vielleicht etwas besser als in der Ausführung. Die Story vom scheinbar nutzlosen Großvater, der die Familie vor Verbrechern rettet. Auch eine Verteidigung des hohen Alters sicherlich, von King nicht umsonst so konzipiert.
„Das rote Display“: toll. Stephen King ist nicht bei allen Feministinnen beliebt, manche halten ihn für einen Mansplainer, und dass er Frauen vor allem dann als Heldinnen inszeniert, wenn sie sich von überstarken Männern emanzipieren können (statt sie sich, um die inflationär gebrauchte Formulierung auch mal zu benutzen: SELBST ERMÄCHTIGEN ZU LASSEN), ist bekannt. Hier ist King sehr klug. Würde der Mann den Körper und Geist seiner Ehefrau besser kennen, müsste er nicht Verschwörungserzählungen anhängen, in denen sie ein Monster ist.
„Ein Fachmann für Turbulenzen“ ist keine schlechte, aber die schwächste Kurzgeschichte in diesem Band. King-Experten wissen, was ein Tranny ist. Die Hauptfigur in dieser Story ist auch einer.
„Laurie“ ist eine Stephen-King-Story, die so klingt, als schreibe er über sich. King ist (Gott sei Dank!) kein Witwer, aber er ist ein Mann gewissen Alters, der ruhige Tage in Florida verbringen will (so wie King selbst seit vielen Jahren, der Knochen zuliebe) und einen Hund geschenkt bekommt. Auch King hat einen Vierbeiner, über dessen Erlebnisse er liebevoll auf Twitter postet, so wenig aufregend sie auch sind. In „Laurie“ kommt ein gefährliches Krokodil ins Spiel, aber King interessiert sich nur für den Hund. Ein guter Fokus, ein Autor mit dem Blick aufs Wesentliche.
Kings schlechtes Gewissen
„Klapperschlangen“ ist die Story, auf die alle gewartet haben. Angekündigt als „Fortsetzung von Cujo“, erzählt King hier nicht den abermaligen Angriff eines tollwütigen Bernhardiners oder etwa dessen Sohn („Son of Cujo“!), sondern von zwei Figuren, die ihn seit Erstveröffentlichung des Romans 1981 nicht in Ruhe gelassen haben: Vic und Donna Trenton, den Eltern des kleinen Tad, der im Auto verdurstete, weil der Hund es belagerte (heute, in der Ära des Mobilfunks und ständiger Erreichbarkeit undenkbar zu erzählen, es sei denn, man befindet sich in den USA in einem Funkloch).
Stephen King sagte es selbst: Der Tod des Jungen ging ihm nahe – er würde ihn heute nicht mehr sterben lassen. Andererseits behauptete er auch, sich an das Schreiben von „Cujo“ nicht mehr erinnern zu können. Er sei damals ständig high oder betrunken gewesen (ein schönes Märchen: Wer kann in einem solchen Zustand einen ganzen Roman verfassen?). Auch deshalb haben ihn Vic und Donna nicht losgelassen. Er fühlt sich für ihren Verlust verantwortlich. Zu Recht. Der Junge hätte überleben müssen.
„Cujo“ enthielt bereits übernatürliche Elemente, „Klapperschlangen“ ist nun eine Geistergeschichte geworden. Vic, mittlerweile 72 Jahre alt, lernt in seinem Feriensitz auf Florida eine Nachbarin kennen, die zu ihren verstorbenen Kindern spricht. Eine Frau, die, wie er sagt, nichts weiter verlangt als die Illusion, ihre vor Zeiten getöteten Jungen wären noch am Leben. Etwas, das er sich für Tad auch wünscht.
In der Nähe dieses Keys in Florida befand sich einst auch Duma Key, nach dem King seinen Geister-Roman von 2008 benannte („Duma Key“, auf Deutsch mit „Wahn“ übersetzt, und das Wort „Wahn“ kommt kursiv hervorgehoben auch in „Klapperschlangen“ vor); die Koralleninsel-Kette ist erneut der Ursprung dämonischer Umtriebe.
Vic und Donna haben sich nach dem Tode Tads scheiden lassen, fanden später aber wieder zueinander. Donna, die den Bernhardiner mit einem Baseballschläger tötete, fehlt gegen den in ihrem Körper wuchernden Krebs aber die richtige Waffe. Als sie im hohen Alter in Vics Armen stirbt, hat sie eine letzte Vision von Tad, mittlerweile erwachsen.
Auch Vic wird ihn wieder zu sehen bekommen – in einer Vision, wie sie auch Danny Torrance in „Doctor Sleep“ von dessen Vater Jack „die Axt“ Torrance“ hatte. Etwas rührselig, sicher, aber King will Frieden schließen mit einem Thema, das seinen Anfang einst im Suff nahm, vor mehr als 40 Jahren. Auch Jack Torrance war, wie King, Alkoholiker.
Sidenote: Ein Polizeiermittler belagert Vic, es ist die Zeit der Pandemie, der Ex-Cop trägt eine Atemmaske. Erst gegen Ende nimmt er sie ab, der Mann hat eine Whiskeyfahne, wie Vic dann erstmals bemerkt. Corona war gut darin, den Menschen ihre Geheimnisse zu lassen, aber irgendwann kommt alles heraus.
Glaubt King an ein Leben nach dem Tod?
„Die Träumenden“ ist purer Lovecraft-Stoff, und die Kurzgeschichte erinnert an Kings „Revival“-Roman. Ein Wissenschaftler glaubt herausfinden zu können, dass Träume einen Weg zum Verständnis des Universums bedeuten können – eine Weltformel, aber geschrieben von Gott. Er nimmt für seine Experimente einen jungen Stenografen unter seine Fittiche, der bald grausamen Experimenten mit Versuchspersonen in einem improvisierten Schlaflabor beiwohnen muss. Von allen zwölf Storys jene mit dem größten Horror; King widmet sie Cormac McCarthy, an dessen lakonischen Schreibstil er erinnern wollte, wie er ihn in dessen letzten Werk „The Passenger“ las. Dafür jedoch schreibt King zu blumig.
Das Buch schließt mit „Der Antwortmann“, eine Story, die King in den 1970er-Jahren begann und dann im Schreibtisch verschwinden ließ. Gut, dass er sie wieder hervorgekramt hat. King selbst hat stets Widersprüche zur Frage zu Protokoll gegeben, ob er an ein Jenseits glaubt – inklusive Wiedervereinigung mit allen geliebten Menschen. „Der Antwortmann“ weiß darauf die Antwort. Man möchte glauben, dass King sich selbst die Fragen stellt, die seine Story-Figur Phil Parker an den „Antwortmann“ richtet. Es wäre ein Trost.
Kings Nachwort ist diesmal sehr lang. Er dankt sehr vielen Menschen. Das ist auffällig. Er dankt seiner Frau, wie immer, auch seinen Schriftsteller-Söhnen, aber auch den Kollegen Richard Chizmar, Stewart O’Nan und dem verstorbenen Peter Straub. Selten war er so ausführlich. Denkt er an einen langsam eingeleiteten Abschied?